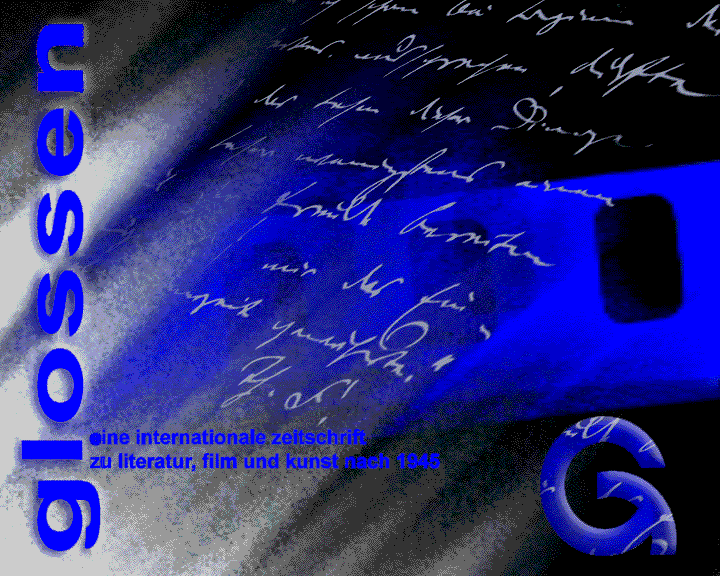|
a peer reviewed scholarly journal on literature and art in the German speaking countries after 1945 ISSN 1093-6025
published at Dickinson
College |
G
l o s s e n: Artikel
Autobiografisch grundierte Rückblicke auf die DDR nach der Jahrtausendwende Der Bücher-Trend der Autobiografien nach 1990 veranlaßte Günter de Bruyn, dieses Genre einer ausführlichen methodischen Analyse zu unterziehen und die Tücken eines selektierenden Gedächtnisses, d.h. vermeintlicher Objektivität kritisch zu durchleuchten. Er optierte für den Begriff "Lesart eines Lebensweges"[1]. Das korrespondiert mit Roy Pascals geradezu klassischer Beurteilung problematischer Selbstinterpretationen: "Die eigentliche Autobiografie [...] ist die Gestaltung einer Persönlichkeit"[2] bzw. der Feststellung eines amerikanischen Theoretikers: "Autobiography is the story of an attempt to reconcile one's life with one's self and is not, therefore, meant to be taken as historically accurate but as metaphorically authentic."[3] Die hier besprochenen literarischen DDR-Rückblicke nach dem Jahr 2000, die von Autoren aus den Generationen um 1930 oder 1940 stammen, sind in der Tat durchaus traditonell als Selbsterkundungen bzw. als versöhnende Versuche einer angestrebten "vollendeten Vergangenheit" zu betrachten, die oft in einer Krisensituation wie Krankheit, Depression, Lethargie oder Trunksucht stattfinden. Ironischerweise ist der jüngste Autor, der der Generation der um 1970 Geborenen angehört und dem Thema mit Lachen begegnet, hauptberuflich Psychiater, also der Heilende. Im wahrsten Sinne des Wortes literarisiert er "Lachen" - will man den Philosophen Odo Marquard zitieren - "als eine Möglichkeit der Distanz zu einer Situation"[4]: "Lachen macht die Zugehörigkeit des Ausgeschlossenen geltend [...] Wir lachen uns lebendig." (daselbst 15). Eingegangen werden soll in dieser Analyse auf Christa Wolfs Roman Leibhaftig[5] (2002), Monika Marons Endmoränen[6]
(2002), Wolfgang Hilbigs Werke Das Provisorium[7] (2000)
und den Erzählband Der Schlaf der Gerechten[8] (2003)
und den Erstling des jungen Jakob Hein Mein erstes T-Shirt[9]
(2001). Die Erzählung Leibhaftig ist sechs Jahre nach Christa Wolfs vorletztem Roman, Medea. Stimmen (1996,) erschienen, was Schreibhemmungen vermuten läßt, denn die Autorin brauchte einen zeitlichen Abstand, um auf die sie aufwühlenden traumatischen Ereignisse des Staatsverlustes in umfassender Prosa zu reagieren. Der Titel suggeriert assoziativ ein Bündel von Bedeutungen. Es ist die Kranken- bzw. Entgiftungsgeschichte einer namenlosen, aber deutlich als die Autorin erkennbaren Patientin, die in der emotionalen Ich-Form spricht, dann wieder, klinisch-nüchtern sich selbst beobachtend, in der dritten Person Singular. Mit ihrem "Leib haftet" sie für Nichtaufgearbeitetes, oder - anders ausgedrückt - sie beschwört und reflektiert den "Leibhaftigen", denn sie fragt sich: "ob es denn auch einen Teufel gibt, der stets das Gute will und stets das Böse schafft. [...] Der Teufel, den ich im Sinn habe, ist der allervernünftigsten Vernunft entstiegen oder (meine Kursivierung) ihr in einem unbeobachteten geschichtlichen Augenblick entwichen". (L 119) Es geht also um die politische "Sache", das utopische "Eigentliche" (L 98), das "Menschenglück" (L 73), das "Köstliche" (L 99) und die Frage: "was machen wir, wenn das Köstliche vorbei ist, ein für allemal vorbei?" (L 99) Das Konzept des "Eigentlichen" bzw. des verpaßten Moments der Verwirklichung, das eine ganze Reihe in der Tradition kritischer Solidarität stehender Autoren - u.a. Volker Braun - beschäftigt hatte, erweist sich also auch weiterhin als krankmachende Reflexion einer weltanschaulich untermauerten, nicht wirklich gelebten, in der Vergangenheit nicht wahrgenommenen Möglichkeit für eine "lebbare" Zukunft. Der Begriff gelungener Teufelsaustreibung würde sich anbieten, sollte der der allervernünftigsten Vernunft entsprungene Leibhaftige nicht doch noch kleine verborgene Nischen und Eckchen im Denken der Kranken/Geheilten gefunden haben. Lassen sich Hinweise dazu in der Erzählung aufspüren? Bewunderer Christa Wolfs werden Leibhaftig als eine Art Aussöhnung
oder Neuorientierung lesen, und Hinweise dafür gibt es viele.
Zweifler dagegen werden den aus Wolfs Sozialisierung erklärbaren
vagen Bereich nicht festlegbarer Zwischentöne in dieser schillernden
"Lesart eines Lebensweges" durchleuchten, einen Bereich,
den die agierende Kunstfigur selbst in der Krankengeschichte im
Präsens artikuliert, "als Schock, daß alles, was
ich sage oder schreibe, verfälscht ist durch das, was ich nicht
sage und nicht schreibe." (L 159) Es geht in den Halluzinationen der Kranken um einen
Abstieg in Hölle und Hades und in die Tunnnel und Schächte
eines seelischen Labyrinths. Dieses Schweben und Gleiten, Andeuten
und Nichtbenennen - das bekannte Stilmerkmal Christa Wolfs - deutet
auf Bewußtseinshaltungen, die sich hier jedoch aus der Natur
der Krankheit erklären lassen, einer verschleppten Bauchhöhlenvereiterung
und der sie begleitenden Fieberträume. Mit diesem Wahn vermischt
sich der Sinn konkreter, mit der DDR verbundener Lebenserfahrungen,
die fragmentarisch ein- und ausgeblendet werden. Diese Todesnähe
gestaltet sich als mythologisches Ereignis, in dem der Narkoseärztin
Kora Bachmann eine nicht unwesentliche Rolle zukommt, denn diese
"Kore" Persephone bringt die langsam Genesende aus dem
Hades zurück in die obere Welt. Oder ist es ein erst am Ende
der Handlung auftretender Arzt, der die Patientin letztlich gerettet
hat, ein dünner Pathologe mit hohlen Wangen und "leblosen",
kalten Händen, der überdeutlich an den Tod bzw. wieder
den Teufel - einen "Abgesandter aus der Unterwelt" (L
165) - erinnert. Nur beiläufig wird sein "tiefschwarzes
Haarfell, dessen Spitze weit in die Stirn hineinreicht" (L
166) erwähnt. Man denkt unwillkürlich an den Teufel traditioneller
Bühneninszenierungen. Aber hier ist es wieder ein "guter",
ein "rettender" Teufel, der "das Leben liebt",
der trotz seines furchteinflößenden Aussehens Hoffnung
gibt, ein Teufel, den es "mitnimmt, wenn ein letaler Ausgang
nicht zu vermeiden war" (L 170-71). Ist es nun jener bereits
erwähnte Teufel, den "ich [die Erzählerin] im Sinne
habe", nämlich die "allervernünftigste Vernunft?"
Die Erzählerin läßt in der Schwebe, wie weit der
Prozeß der Desillusionierung mit ihrem vergangenen Staat oder
damit, was dieser Staat als Hoffnung einmal verkörperte, nun
wirklich abgeschlossen ist. In einer in ihren Fieberphantasien und
Halluzinationen stattfindenden dialogischen Auseinandersetzung mit
dem früheren Freund Urban, der zum Funktionärstypen im
Realsozialismus wurde, heißt es beiläufig, jedoch aufschlußreich:
"Der neue Mephisto, sagte sie. Verführung nicht mit Unsterblichkeit,
sondern mit Stillstand. Du gibst also alles verloren. -- Ja. Jedenfalls
für diese Epoche (meine Kursivierung). Sie war ungeeignet für
unser Experiment. Wir waren auch ungeeignet, wir ganz besonders."
(L 183). Es ist letztlich Sache des Lesers zu bestimmen, ob es sich
um eine wirklich gelungene Entgiftung handelt oder vielmehr um die
Akzeptanz der Unwiederbringlichkeit einer - im Moment noch ! - versäumten
geschichtlichen Möglichkeit. Die Geschichte endet mit einer Träne. Die Genesende/Genesene
spricht mit ihrem Mann, den Blick auf einen See gerichtet: "In
der Natur ist es aber auch schön, sagst du. Ich sage, ja, es
ist schön.-- Du sollst ja nicht weinen, sagst du. -- Das, sage
ich, steht auch in einem Gedicht." (L 185) Was bleibt, ist
also die Kunst, die Beschäftigung mit Literatur, die im Falle
Christa Wolfs nicht aus dem Kontext einer (politischen?) Sinnfrage
zu nehmen ist. Dazu die Autorin in einem "Interview" aus
dem Jahre 2001: Auch in einer durchtechnisierten Welt stellt
sich für viele Menschen nicht nur das Problem, die tödliche
Langeweile zu vertreiben, sondern auch die Sinnfrage. Für beide
fundamentale Bedürfnisse ist Literatur gefragt. Und es kann
ja sein, daß die Einsicht zunimmt, daß eine starke Subjektivität
und der Mut, sie auszudrücken, auch in einer auf Effizienz
getrimmten Gesellschaft unverzichtbar sein können.[10] Auch in Monika Marons fiktivem, aber autobiografisch grundiertem Roman Endmoränen (2002) geht es - der Signaltitel
verweist auf von Gletschern bewegten Schutt und ein "Ende"
- um die Bewältigung historisch-biographischen Schutts und
um eine Neuorientierung, die in der Isolation eines mecklenburgischen
Sommerhauses erkämpft wird. Die Bewältigung von politischen
und beruflichen Wendepunkten und Zäsuren ist bei Maron gekoppelt
mit einer lähmenden Reflexion des Älterwerdens, des Verblassens
erotischer Ausstrahlung und der damit verbundenen psychischen und
existenziellen Probleme. Der Heldin, eine Kunstfigur mit dem Namen
Johanna, gelingt am Schluß der Handlung "ein wunderlicher
Anfang" (E 253): die Befreiung aus dem Käfig der Teilnahmslosigkeit
und des Zwangsgedankens, daß sie das Neue, "Eigentliche
nach [meine Kursivierung] dem Wunder" (E 40) der Wende verpaßt
habe, weil sie "kampflos" und apathisch in einem noch
in der DDR-Sphäre verwurzelten "selbstgewählten Koordinatensystem"
(E 87) verharrt hatte. Das zeitliche Verlegen des ent-ideologisierten
"Eigentlichen" in die gesellschaftlichen Strukturen der
Bundesrepublik steht in deutlichem Gegensatz zu der fragwürdigen
Erlösungsgeschichte Christa Wolfs. Die zwölf Jahre später,
1941 geborene Monika Maron, die aufmüpfige Stieftochter des
DDR-Innenministers Karl Maron, die sich abrechnend gegen ihre eigene
Herkunft definierte, hatte mit dem nebulös-utopischen "Eigentlichen"
und der für Wolf typischen "kritischen Solidarität"
längst abgerechnet. Marons Werk sei daher ein "Pendant
[zum] Roman Leibhaftig", so die harte Kritik eines Rezensenten,
"ohne die Tendenz zur Selbstaufbahrung und zum sakralen, weichzeichnenden
Kitsch."[11] Wer ist die Heldin in den Endmoränen? Sie ist eine Intellektuelle, die zu DDR-Zeiten Verfasserin
von Biographien sowie von Vor-und Nachworten war, in denen sie Botschaften
politischer Unbotmäßigkeit und stillen Widerstands versteckte.
Ihr Mann Achim tat ähnliches, indem er Kleist gegen die offizielle
Linie interpretierte. Diese sanfte Aufmüpfigkeit und die oft
aufreibenden Kämpfe mit dem Zensor gab den DDR-Gelehrten ein
Gefühl subversiven Gebrauchtwerdens in der maroden Gesellschaft,
das von Johanna nach der Wende nicht neu reflektiert, ja, von ihr
geradezu mißverstanden wird. Das Leben nach "dem Wunder"
bedeutete für sie nicht ein Neuerfinden ihrer Biographie mit
neuen Herausforderungen und Kämpfen, sondern eine stagnierende
Erleichterung, "daß ich endlich aufhören durfte
zu kämpfen [...] Ich habe damals vor allem das Ende dessen,
was wir für ewig gehalten hatten, gefeiert und darüber
wohl den Anfang vergessen." (E 214). Angelangt in der neuen
Freiheit, haben beide, Johanna und ihr Mann Achim, im Älterwerden
ihr Ziel verloren, "die schöne, quälende Aufregung,
wenn man verliebt ist oder für etwas kämpft." (E
31). Die Verfasserin verschlüsselter Botschaften fragt sich
in diesem Zustand der Stagnation, ob sie überhaupt noch schreiben
soll, tut es trotzdem, fühlt sich aber in der offenen, rein
von Marktgesetzen bestimmten Bundesrepublik überflüssig,
nutzlos, depressiv, müde und alt. Sie zieht sich in ihr abgelegenes
Sommerhaus zurück. Die akute Bewußtwerdung der Unbilden
und Schrecken des Alterns tut ein übriges. Langsam und immer wieder abbrechend schreibt Johanna in ihrer selbstgewählten Isolation an der historischen Biographie von Wilhelmine Enke, der Mätresse und Dauervertrauten Friedrich Wilhelm II, eine Lebensgeschichte, die in dem auf Entertainment getrimmten Literaturbetrieb der Bundesrepublik sicherlich von sehr begrenztem Interesse ist. Aber welche, Johanna selbst wohl unbewußten Kräfte motivierten sie, sich dieser Vita zuzuwenden? Liegt darin gar eine verschlüsselte, an sie selbst gerichtete Botschaft? Enke, aus armen Verhältnissen stammend, hatte durch die Förderung des Königs "die Chance eines zweiten, unverhofften, ihr durch Geburt nicht zugedachten Lebens" (E 215), und inmitten höfischer Intrigen verteidigte sie es kämpferisch "mit Klauen und Zähnen" (E 215). Nach dem Tode des Königs heiratete sie, fast 50 Jahre alt, einen jungen Dichter, der gerade 23 Jahre alt war. Eine Parallele dazu findet Johanna in ihrem eigenen Bekanntenkreis: die Ehefrau eines Freundes, mit dem sie korrespondiert, hat die festgefahrenen Ehestrukturen hinter sich gelassen und sich einem weitaus jüngeren Mann zugewandt. Dazu Johannas Kommentar: "Entweder man glaubt, für Umstürze jeder Art zu alt zu sein, oder man glaubt es nicht. Kathrin hat es nicht geglaubt, und es geht ihr, soviel ich weiß, immer noch gut." (E 161). Handelt es sich also um einen unkonventionellen
"sinnenfrohen Gegenentwurf zu dem etwas mürben Abgesang
in eigener Sache"[12] - wie ein Kritiker meint ? Da auch Johannas
eigene Biographie - wenn auch nur beiläufig - mit einer sinnenfrohen
Nacht endet, darf man es annehmen. Aber hinter diesem episodenhaft
"kreatürlichen" Ende verbirgt sich mehr, letztlich
auch ein struppiger schwarzer Hund, der die Heldin am völlig
offenen Schluß der Handlung zumindest wieder in das "wirkliche"
und "eigentliche" Leben zurückführt. Doch auch
dahinter verbirgt sich mehr. Das bei Maron auf die Zeit nach der Wende verschobene
"Eigentliche" suggeriert in Endmoränen den
Gedanken des verpaßten Moments, allerdings im Vergleich zu
Christa Wolf in monumentaler Neuinterpretation. Auch hier wieder
- geschickt verpackt und daher auf den ersten Blick nicht sofort
erkennbar - geschieht das in Form eines Symbols, das den Gedanken
an den Teufel suggeriert, ohne daß dieser je genannt wird.
Das Konzept kämpferischer Selbstbehauptung und Eigeninitiative,
auch unter den härtesten Bedingungen, spiegelt sich leitmotivartig
in der beiläufigen Erwähnung verschiedener Hunde, Hunde,
die beispielsweise hinterm "Balkongitter" versteckt "Kontakt
suchen" (E 46) oder, "aus dem Zwinger" (E 194) entlassen,
"rührend stolz" ihren Besitzer begleiten. Es nimmt
kaum wunder, daß sich der "wunderliche Anfang" der
neuermutigten, kontaktsuchenden Heldin Johanna am Ende ausgerechnet
in der unspektakulären Sorge um "etwas Schwarzes",
um einen herrrenlosen, struppigen, widerspenstigen Hund spiegelt
- "Er war eine Mischung aus Schnauzer und noch etwas"
(E 252) - den sie an einem Strick aus dem Auto zerrt. "Sinnbildlich",
also in symbolischer Referenz zum "noch etwas", tauche
der schwarze Schnauzer auf - meint der Kritiker Ralph Gambihler
- und "viel kraftvoller [zerre er] an der Leine als der Pudel
aus Faustens Grübelverlies."[13] Unaufdringlich benützt
Maron also die Goethesche Folie, nach der des Pudels Kern in der
Botschaft liegt, Faust aus der lähmenden Isolation seines Studierkerkers
herauszuholen, um ihn am "wirklichen" und "eigentlichen"
Leben teilnehmen zu lassen: "Damit du, losgebunden, frei, /
Erfahrest, was das Leben sei." (Faust 1 - "Studierzimmer").
Auch Johanna beendet letztlich ihren "haustierähnlichen
und gänzlich unnützen Zustand" (E 83) im Käfig
depressiver Teilnahmslosigkeit und kehrt nach Berlin zurück.
Die Altersmelancholie, die auf weite Strecken über der Handlung
schwebte, allerdings mit Selbstironie und Witz immer wieder neu
durchbrochen wurde, endet mit einer Geste nützlichen Zupackens
und Sichkümmerns. Wie es im Beruf, im eigenen Eheleben oder
in den politischen Strukturen der Bundesrepublik weitergehen wird,
bleibt zwar offen. Was aber bleibt, ist vitale Entschlossenheit:
"Man müsse vor allem im eigenen Leben dafür sorgen,
daß es zu jeder Zeit genügend Anfänge gibt, glückliche
Anfänge." (E 240) Der - wie Maron - ebenfalls im Jahre 1941 geborene
Wolfgang Hilbig veröffentlichte im Jahre 2000 den Roman Das
Provisorium, dem drei Jahre später eine Sammlung von Erzählungen Der Schlaf der Gerechten folgte, in der zwei Texte neu sind,
die anderen fünf bereits vorher erschienen, aber hier umgearbeitet.
Im Provisorium erzählt die im Schaffen Hilbigs bereits bekannte fiktive Kunstfigur "C" in der dritten Person Singular, in den Erinnerungslandschaften der sieben Prosastücke ist es ein Ich. Beide Werke sind unmißverständlich autobiografisch geprägt. "Ein Veränderter" - oder ist es ein Unveränderter in einem Status quo, der sich zu ändern versucht? - "blickt auf sich selbst zurück und nennt sich 'er',"[14] resümiert eine Kritikerin. Geht es in Christa Wolfs Erzählung um die symbolisch verdichtete, weltanschaulich befrachtete Figur des Leibhaftigen und bei Maron um des Pudels Kern einer biographischen Neuerfindung, so gestaltet Hilbig die innere Hölle einer Sucht mit dem Teufel als Monster, von dem es heißt: "Eines Tages, das war ihm klar, mußte er das Monster, das seinen Innenraum besetzt hielt, beschreiben und es der Öffentlichkeit ausliefern." (P 133) Ebenfalls im Kontrast zu Haltungen von kritischer Solidarität, Dissidenz oder Aufmüpfigkeit, ist das Scheitern des Protagonisten in seiner Privatwelt und im Staatsbereich von DDR und BRD unabhängig von materiellen oder ideologischen Zwängen allein in dessen Psyche begründet. Hilbig, aufgewachsen in einer Bergarbeiterfamilie in einem Tagebaugebiet in Meuselwitz bei Leipzig, hatte in verschiedenen Industrieberufen gearbeitet, darunter lange als Heizer. Völlig abgeschottet vom ost-westlichen Literaturbetrieb und den literarischen Diskussionen um ihn herum, begann er zu schreiben: eine Randfigur, ein Außenseiter, Einzelgänger, Unbehauster, ein Unvereinnahmter, der an den in seiner DDR-Sozialisierung wurzelnden Minderwertigkeitskomplexen litt und leidet. Die untergeordnete Stellung eines Heizers innerhalb der in der DDR glorifizierten Arbeiterklasse, der Gedanke des Hilfsdienste-Leistens in einer minderen Form des Werktätigenstatus wurden ihm zum Sinnbild der Isolation eines aus der Bahn geworfenen Schriftstellers, der am öffentlichen Leben nicht teilnimmt oder nicht teilnehmen will, also in einem Niemandsland lebt. Er verfällt dem Alkohol, leidet an Schreibhemmungen, ein Problem, mit dem er ringt, als er langsam zu einem öffentlichen Schriftsteller mit einer gewissen Resonanz geworden war. Handlungsauslösend im Provisorium ist
das Jahr 1985, in dem er - ausgestattet mit einem Ausreisevisum
in die BRD - den nicht endenwollenden Teufelskreis von rastlosem
Hin und Her zwischen den beiden deutschen Staaten beginnt. Symbol
dieses existenziellen Provisoriums sind die Bahnhöfe mit Zügen,
die zwar abfahren, aber nie am Ziel einer Neuorientierung eintreffen.
War dem Protagonisten/Autor das verhaßte Milieu der DDR zwar
Provisorium, aber auch Grundlage seines Schreibens, so fehlten ihm
im Westen, den er ebenfalls als Provisorium erlebt, die gehaßten
Reibungsflächen, die zur Stimulans seines Schreibens wurden.
Ausbrechen aus dem "DDR-Käfig" hieße Gefährdung
seines Künstlertums, waren doch die dortigen paranoiden Machtstrukturen
mit ihren Ein- und Ausgrenzungen Quelle seiner Inspiration, seiner
Visionen und Halluzinationen. Der Teufelskreis von Schreibhemmung
und Alkoholrausch setzte das innere Monster frei: "mit dem
Körper als Schlachtfeld," - so Jörg Magenau - "in
einem permanenten Übergang - oder im Untergang."[15] Der Roman ist kreisförmig angelegt. Ausgehend
von einer surrealistisch gestalteten Episode auf der Fußgängerzone
in Nürnberg, wird im Rückblick von den Jahren 1985 bis
1989 in ständiger Durchbrechung der Zeitebenen berichtet. Der
Roman endet auf dem Leipziger Hauptbahnhof mit einer täuschenden
Lichtmetaphorik, der Helligkeit eines kapitalistischen Reklamelichtes
"AEG". Die deutsch-deutsche Grenze hat sich aufgelöst,
nicht aber die Probleme und Obsessionen des Protagonisten. Hilbig
kommt vom Thema "DDR" nicht los, dem Verrotteten und Zerstörten,
dem Abgrund seiner eigenen Psyche. Sein Thema sind die Abraumhalden
seiner Heimat, die Keller und Öfen, die zu Spiegelungen der
eigenen Existenz und Süchte werden, ein Dasein am Rande einer
Existenz, an dem sich auch in der Bundesrepublik nichts verändert
hat. In der neuen Erzählung "Der dunkle Mann" aus
dem Schlaf der Gerechten erklärt er, warum "eine
der schönsten Gegenden Deutschlands unterhalb des Pfälzer
Waldes", wo er damals wahlweise lebte und nie seßhaft
geworden war, bislang in keinem seiner Texte vorkam: Obwohl ich schon seit einigen Jahren hier lebte,
schrieb ich immer weiter über die horizontweit sich erstreckenden
Mondlandschaften im Süden von Leipzig, immer weiter über
die kleine Industriestadt, in der ich geboren worden war, die umgeben
war von Tagebauen, aus denen einst, bis in unergründliche Tiefen
hinab, die Braunkohle gefördert worden war. Inzwischen gab
es da nur noch tote, stillgelegte Tagebaue, und es war, als ob jene
Landstriche dort einer unaufhebbaren Nutzlosigkeit anheimgefallen
waren, einer Unbrauchbarkeit, die auch jeden meiner Gedanken in
ihre Tiefen riß, um ihn dort stillzulegen und nutzlos zu machen.
(SG 144) Der Protagonist/Autor muß über dieses
Thema schreiben, denn, hier die Therapie, schreibend geht er nicht
unter. Die Handlung gestaltet die Transitexistenz und den
Schwebezustand des von Lesung zu Lesung fahrenden Autors C. Die
Orte dieses Provisoriums sind Leipzig, Frankfurt/M., Hanau, Nürnberg
und immer wieder Meuselwitz, wo das Ich zum Schriftsteller wurde.
Vereinnahmung fürchtend, findet er weder Halt bei seiner Leipziger
Lebensgefährtin Monat noch bei der Nürnberger Schriftstellerin
Hedda, die ihn schließlich verläßt. Er versucht,
seine Probleme mit Alkohol zu betäuben, kann nicht mehr schreiben,
weil er nur noch mit Trinken beschäftigt ist und trinkt, weil
er nicht mehr schreiben kann. Alkoholismus erzeugt akuten Selbsthaß,
der sich gegen den eigenen Körper wendet, ein Haß, der
aber bereits im Osten angelegt war: "Diesem Land, triefend
von Schwachsinn, verkrüppelt vor Alter, zermürbt und verheizt
von Verschleiß und übelriechend wie eine Mistgrube, dieses
Land hatte ihn mit Vergängnis gefüttert und seine Reflexe
gelähmt, es hatte ihm die Lust aus den Adern gesogen; dort
war sein Gehirn verkalkt, wie die Mechanik einer alten sklerotischen
Waschmaschine. Er war diesem Land zu spät entwichen ..."
(P 151). Der drei Jahre später erschienene Band von Erzählungen Der Schlaf der Gerechten - mittlerweile hat Hilbig immerhin
fünfzehn Jahre an Westerfahrung aufzuweisen - scheint diesen
Gedanken fortzusetzen, denn es geht in den einzelnen Texten um die
erdrückende Enge einer Kindheit ohne Vater, einen Frauenhaushalt,
das Heizermilieu, die Trunksucht des Großvaters, Schlick und
Schlamm in einer verwüsteten Landschaft und immer wieder um
die Ascheglut des Tagebaus, in der ein Pferd versinkt; später
dann, im Westen, um die in ost-westlichen Sozialisierungen wurzelnden
Konflikte mit der Ehefrau. Dann jedoch, in der letzten Erzählung
"Der dunkle Mann", kommt es zu einer surrealen Art von
Befreiung: das Ich - verfolgt von einem ehemaligen Stasiagenten,
der von seiner eingeübten Tätigkeit nicht los kann - ergreift
die Initiative und löst das Problem. Er ermordet den mephistophelischen
Verfolger: einen Doppelgänger, ein Alter Ego, in grotesker
Verzerrung einen Abklatsch seiner selbst? Gelingt ihm die Befreiung
von den Gespenstern der Vergangenheit oder wird das künstlerische
Autor-Ich auch in Zukunft zu den zentralen Themen zurückkehren?
Hilbigs Werke enden offen, ohne die bei Wolf und Maron sichtbare
Geste des Sich-Zusammenraffens bzw. der Versöhnung. Es ist in diesem Kontext interessant zu erfahren,
was Hilbig selbst - ohne das Gewand der Poesie - in Interviews herausstellte.
Vor der Publikation des Provisoriums bezeichnete er 1999
-- ganz in Übereinstimmung mit der fiktiven Erzählfigur
des Romans -- in einem Gespräch in der Frankfurter Rundschau seine Grenzgängerjahre von 1985 bis 1989 als einen Zustand,
der "weder Fisch noch Fleisch [war]. Weder Ost noch West. Man
war nicht richtig hier, und dort war man auch nicht richtig."[16]
Dieses Verweilen im Niemandsland erhärtet er ein Jahr später:
"Ich bin kein 'DDR'-Autor mehr, aber sicher auch kein sogenannter
gesamtdeutscher Schriftsteller."[17] Dann, im Jahre 2002, kurz
bevor er den Büchner-Preis erhielt, faßte er es in einem Spiegel-Gespräch wiederum sehr ähnlich: "Ich
bin ja bis heute nicht seßhaft geworden [...] Leben habe ich
nicht gelernt, aber schreiben -- denke ich manchmal."[18] Über
die kathartische Rolle des Schreibens in seinem Leben sinniert er
folgendermaßen: "Beim Schreiben, das ist die einzige
Zeit, wo ich konzentriert bin, wo auch meine Ängste abfallen
von mir. Wo ich mich sicher fühle." Dann aber schränkt
er ein: "Das ist ja nicht das Leben, sondern nur ein schriftliches
Leben." (daselbst; Spiegel-Gespräch). Auf dem Hintergrund
dieser Aussagen ist Das Provisorium folglich nicht nur Ausdruck
einer Schreibkrise und eines Versagens, sondern ein partieller Befreiungsschlag,
die geglückte Auslieferung des "Monster[s], das seinen
Innenraum besetzt hielt"(P 133) an die Öffentlichkeit.,
ein, will man skeptisch sein, zumindest temporäres Überstehen
der Höllenfahrt. Ein optimistischerer Hinweis auf eine Neuorientierung
ließe sich allerdings aus der Erleichterung des Ichs nach
der halluzinatorischen Ermordung des "dunklen Mannes"
aus dem Schlaf der Gerechten erschließen: "Der
Leichnam war nicht mehr zu sehen. Alles, was er über mich gewußt
hatte -- während ich von ihm nur gewußt hatte, daß
er mir sehr ähnlich gewesen war --, war mit einem Mal verschwunden
[...] Noch bevor Mutter aufstand, war ich im Bett und schlief so
tief wie lange nicht mehr, wie früher nach einer mühsamen
Nachtschicht und ohne eine einzige Schlaftablette" (SG 190).
Das zukünftige Werk Hilbigs wird Aufschluß geben. Mittlerweile
gilt, wie Wilfried Schöller es so treffend faßt: "Die
letzte Zuflucht nach dem Ortswechsel ist der Roman."[19] Mit einem grundsätzlich anderen Erfahrungsbereich
- primär Kindheit oder realsozialistische Pubertät - und
daher mit einem ganz anderen Erzählton melden sich junge Ost-Autoren,
die in den siebziger Jahren geboren wurden. Entdeckten westdeutsche
Autoren im Gefolge von Florian Illies' Bestseller Generation
Golf die Bundesrepublik als Erzählort für autobiografisch grundierte Rückblicke auf die siebziger und achtziger Jahre, so ist es jetzt -- wie es der Titel eines Interviews faßt -- auf östlicher Seit die "Generation Trabant"[20]. Unter den Neuerscheinungen, die sich häufen, sind bespielsweise Jana Hensels Zonenkinder, Andre Kubiczeks Junge Talente,
Julia Schochs Der Körper des Salamanders, Jakob Heins Mein erstes T-Shirt und das DDR-Buch der westdeutschen Journalistin
Susanne Leinemann Aufgewacht. Mauer weg. Das Thema dieser
Werke sind die endsiebziger und achtziger Jahre, eine Zeit also,
in der die DDR schon klar im Zustand des Verfalls erkennbar war.
Mehr als zehn Jahre nach der Wende stellen die jungen Autoren gelassen
groteske Situationen und extrem autoritäre Verhaltenweisen
dar, deren bloßes Erwähnen Heiterkeit und Lächeln
auslösen. Jakob Hein, Sohn des Schriftstellers Christoph Hein,
erklärt diese humorige Gelassenheit folgendermaßen: "Wir
wurden zwar andauernd bespitzelt, kontrolliert, ins Polizeirevier
abgeführt und verhört [...] von der Stasi fotografiert
- aber wir haben das schon nicht mehr richtig ernst genommen. Auf
uns wirkte das schon recht lächerlich. Wie ein zahnloser Hund,
der früher mal beißen konnte, aber heute nicht mehr knurren
kann. Meine Eltern haben das alles noch anders gesehen"[21],
wie die oben erwähnten Rückblicke der Autoren aus früheren
Generationen das ja bezeugen. Für den jungen Hein -- das Kind
und den Teenager während des Mauerfalls -- gilt daher eher
das Motto für das Kapitel "Die schlimmsten Jahre"
aus dem Werk Mein erstes T-Shirt: "Die DDR war für
Jochen Schmidt keine Angsterfahrung." (T 45) Mein erstes T-Shirt ist eine Sammlung von 26 humorig-witzigen Alltagssilhouetten bzw. kurzen Anekdoten aus einer Kindheit in der DDR, präsentiert von der wechselnden Perspektive eines Kindes und eines pubertierenden Teenagers. Hier bedient sich Hein einer Maske, einer Ausdrucksweise, die typisch für eine Sonderform des Komischen ist, nämlich der Ironie. Der Sprecher ist eine Ich-Figur, dessen Tonfall ein Konstrukt von Nachwende-Reflexion und kindlich-altkluger Pseudo-Naivität ist. Diese Sprechhaltung wird in Heins autobiografisch eingefärbtem Rückblick konsequent durchgehalten. Zitiert sei Friedrich Georg Jünger zu dieser Sonderform des Humors: "Es gibt keine Ironie ohne Maskierung. Im Zusammenhang damit steht, daß ein Zweifel darüber entstehen kann, ob etwas ironisch oder ernsthaft gemeint ist, dort nämlich, wo das Verhüllte der ironischen Äußerung nicht zugleich erkannt wird."[22] Zum Aspekt des Autobiografischen selbst und der Authentizität seines Werkes meinte Hein: "Die Texte sind ehrlich. Das heißt, das Ich verhält sich kongruent, weil das Ich ich bin. Und insofern ist das Buch einfach richtig. Aber es ist keine reine Autobiografie. Da ist natürlich Fiktion dabei."[23] In einem anderen Gespräch führt er weiter aus: "Vieles davon habe ich selbst erlebt, aber nicht alles. Was allerdings stimmt: in jeder Geschichte verhält sich "Ich", wie ich mich verhalten hätte."[24] Es handelt sich in diesen anekdotischen Miniaturen zunächst um Kindheits- und Teenagererlebnisse, die allgemeingültig und typisch sind, ob der Erlebende nun im Westen oder Osten lebt -- all das in einer Sprache berichtet, die "cool", "schnafte", "total gut" oder "tüffig" ist. Über die Kindergartentante, die Angst einjagt, wird berichtet, über autoritäre Lehrer, Lehrer mit Marotten oder Alkoholproblemen, über eine "Erziehung, [die] gegen alles, was Spaß macht, ausgerichtet [war]", typische Kinder- und Jugendstreiche, erstes Sich-Betrinken, eine E-Gitarre, westliche Musik, Erlebnisse mit Mädchen. All diese Erlebnisse gestaltet Jakob Hein auf Ost-Folie, zu der sich dann die groteske Komik des verfallenden Realsozialismus gesellt. Hein kommt aus systemkritischer Familie. Dazu meint
der Ich-Sprecher in den einzelnen Miniaturen: "Ich wuchs in
einem Haushalt notorischer Nestbeschmutzer auf. Meine Eltern hatten
beide Philosophie studiert, nur um jetzt alles besser zu wissen
als die Partei- und Staatsführung. Mein Vater war so etwas
wie ein Beelzebub des Sozialismus." (T 124-125). Diese Einflußsphäre
bestimmt den ironisch-komischen Ton des Berichtenden. Es geht generell
um das Gesetz der siegreichen Arbeiterklasse im Sozialismus, im
normalen Leben z.B. um die Gefährdung des Sozialismus. Wenn
die Schüler keine Hausaufgaben machen oder Westfernsehen gucken
oder wenn sie Comics lesen: "Da waren alle Arbeiter und Bauern
traurig." (T 48) Es geht um Aushorchen und die Suche nach dem
Klassenfeind in den Schulklassen, wenn der Lehrer sich z. B. erkundigt,
ob die Fernsehuhr zu Hause Striche (West) oder Pünktchen (Ost)
habe. Auch beim Abgeben von leeren Flaschen wirkt das Gesetz der
siegreichen Arbeiterklasse, wenn man für Schnapsflaschen dreißig
Pfennig, für die Rotweinflaschen der Eltern aber nur fünf
Pfennig erhält. Es geht um die Stärkung des Sozialismus
und die Erhaltung des Weltfriedens, wenn die Schüler vorabgedruckte
Protestbriefe an den amerikanischen Präsidenten schicken und
dieser sich zutiefst erschüttert wundert, "wie denn ein
Jakob Hein aus Ostberlin ihm da wieder auf die Schliche gekommen
war." (T 51) Ähnlich vergnügliche Episoden häufen
sich. Das Buch endet mit der schon nicht mehr ernst zu nehmenden
Inhaftierung des Achtzehnjährigen und dem Fall der Mauer. In
der dann folgenden Wende geht der Ich-Sprecher - so der Schluß
der Berichte - "auf die Suche nach neuen Lebenszielen in der
Wunderwelt des Kapitalismus." (T 150) Zusammenfassend läßt sich sagen, daß
die hier besprochenen Rückblicke auf die DDR sich primär
im Ton der Aussage unterscheiden, der -- je nach Generationszugehörigkeit
des Autors -- geprägt ist von sich ändernden politischen
Situationen, der spezifischen sozialen Lage eines Sprechenden, von
einstigen Hoffnungen der DDR gegenüber, von enttäuschtem
Wunschdenken, Frust, Rebellion oder amüsierter Langeweile.
Die 1929 geborene Christa Wolf erlebte ihren neuen "besseren"
Staat zunächst in einer Auseinandersetzung mit der Hitlerzeit
und dem Antifaschismus. Lange identifizierte sie sich mit der DDR,
stand ihr "mit kritischer Solidarität"[25] gegenüber.
Sie schreibt also anders, rechtfertigender, als die zehn Jahre später
geborene streitbare ehemalige Funktionärstochter Monika Maron,
die kritische Solidarität nicht mehr nachvollziehen konnte,
mißtrauisch und abtrünnig wurde und schließlich
sogar ihrem Staat mit Widerstand begegnete. Wolf schreibt auch anders
als der, wie Maron im Jahre 1941 geborene, "schreibende Arbeiter"
Wolfgang Hilbig, der keinem System zugehörig war und seine
Inspiration von "unten" empfing, aus den Tiefen einer
nichtglorifizierten wirklichen Arbeiterwelt, aus seelischer Verwüstung
und Sucht. Der Generation der um 1970 Geborenen, z.B. Jakob Hein
(1971), die weitgehend frei war von politischen oder aus dem Politischen
resultierenden Traumata, gelingt dann der lockere, zwischen Satire
und Nonsense changierende, entspannte Ton für die Gestaltung
eines Staates, "der recht lächerlich wirkte. Wie ein zahnloser
Hund, der früher mal beißen konnte, aber heute nur noch
knurren kann."[26] Generell vermittelt sich der Eindruck bei
den einzelnen generationsgebundenen "Lesarten eines Lebensweges",
daß die zeitliche Distanz von der DDR die Aussage prägt.
Die erregten Stasi-Debatten, Literaturstreitereien und öffentlichen
Anschuldigungen gehören der Geschichte an, einer Geschichte,
von der man sich zwar nicht völlig lösen kann, die man
aber nolens volens im Sinne einer historischen Ablösung, vielleicht
sogar einer Erlösung erleben muß oder kann. 1
| |