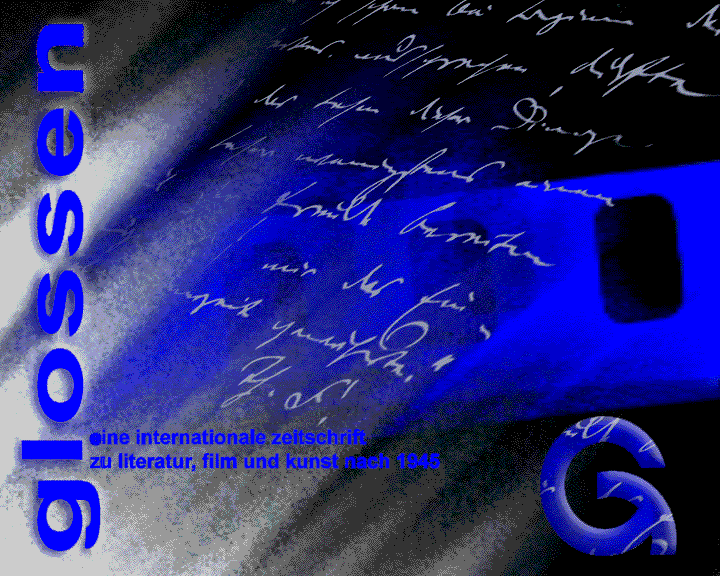|
a peer reviewed scholarly journal on literature and art in the German speaking countries after 1945 ISSN 1093-6025
published at Dickinson
College |
G
l o s s e n: Rezensionen
Das andere deutsche Trauma: Vertreibung,
Lager, Flucht
Martha Kent, Eine Porzellan-Scherbe im Graben, Frankfurt/M.: Scherz Verlag, 2003. 336 S. Martha Kents Buch Eine Porzellan-Scherbe im Graben stellt einen Aspekt weitgehend unbekannt gebliebener Vergangenheit aus der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg vor, der gerade jetzt höchst aktuell ist. Seit einiger Zeit werden in den öffentlichen Medien verstärkt Elemente deutscher Geschichte debattiert, die bis vor kurzem zum großen Teil nur unterschwellig berührt oder gar nicht wahrgenommen wurden. Daß die deutsche Bevölkerung auch große Verluste erlitten und Leid erfahren hatte, wurde bisher gewissermaßen als Konsequenz eines verlorenen Krieges verbucht und als Sühne für die große Schuld am Holocaust in Rechnung gestellt. Nach der Devise „mitgefangen, mitgehangen“ wurden die eigenen Opfer dem Gang der Welt zugeordnet und und stillschweigend weggesteckt. Es war nun so, daß die meisten Deutschen—ob sie nun am Naziunwesen teilhatten oder nicht—nach Kriegsende den Blick zurück auch deshalb nicht wagen wollten, weil beim Wiederaufbau eine Beschäftigung mit den vergangenen deprimierenden persönlichen Erlebnissen die Tatkraft zu schwächen drohte. Ein Blick in die Zukunft erschien emotionell ergiebig, eine Rückbesinnung hingegen lähmend. Das Trauma blieb unterdrückt. Das hat sich in letzter Zeit geändert, und Martha Kents Buch gehört zu den Veröffentlichungen, die an die Leiden der Deutschen erinnern. Die Schuld am Holocaust hingegen erfuhr bekanntlich schon seit den 70er Jahren eine intensive Aufarbeitung. Der hier gewünschte Schlußstrich, der seit Ende der 90er Jahre gezogen werden sollte, diente nach Meinung einiger Prominenter der Abschaffung der sogenannten Moralkeule (wie Martin Walser es nannte), die eine neue Generation ernsthaft behindere. Es wird die Frage in die Debatte eingeworfen, ob es für die deutsche Nation angebracht sei, sich plötzlich auf ihre Opferrolle zu besinnen, und dadurch quasi von einer historischen Schuld abzulenken, bzw. ähnliche Schuld auch anderweitig zu lokalisieren, um die eigene zu relativieren. Dazu werden Stimmen besonders der jüngeren Generation laut, die diese Art Aufrechnung als zu einseitig sehen, denn langsam kämen unbekannte Einzelheiten aus der Kriegs- und Nachkriegszeit ans Licht, die Beachtung finden sollten. Die Kinder und Enkel verlangen nunmehr nicht allein Antworten auf die Schuldfrage der Väter, sondern auch eine Erklärung der Leiden der Familien, deren Konsequenzen sich erst mit der Zeit manifestierten, und von denen auch sie betroffen sind. Die verheerenden Folgen von Luftangriffen
auf Deutschland und die Vertreibung aus der östlichen Heimat
werden auf menschheitsrechtlicher Basis in Frage gestellt. Es wird
dabei anerkannt, daß Nazideutschland zuerst in England mit
Bombenangriffen und in Polen mit Vertreibungen angefangen hatte,
und daß diese Taten zu recht verurteilt werden. Aber es wird
auch gefragt, ob die Massenvernichtung der deutschen zivilen Bevölkerung
grundsätzlich zu rechtfertigen sei. Etwas scheint nicht in
Ordnung zu sein, wenn noch heutzutage einige der alliierten Mächte
in ihren Ländern bei den alljährlichen Gedenkfeiern zum
Beispiel die Männer, die in Bombenflugzeugen gegen Deutschland
flogen, als Helden und Retter der freien Welt feiern, aber nicht
daran erinnern, dass ein Großteil der deutschen Opfer im Zweiten
Weltkrieg aus der Zivilbevölkerung, aus Frauen und Kindern
bestand, die Leben, Gesundheit, Heim und Besitz verloren, ohne eine
Kriegsschuld zu haben. Erst Ende der neunziger Jahre hat z.B. W.G.
Sebald als einer der Ersten Informationen über das erschreckende
Ausmaß des Bombenkrieges wirksam publik gemacht (zuerst in
einem viel beachteten Spiegel-Artikel, 3/1998). Sodann erschien
Jörg Friedrich’s Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg
1940-1945, Propyläen Verlag, München, 2002), in dem
Hundertausende von Frauen und Kinder umkamen. Erst Anfang des neuen
Milleniums hat u.a. Guido Knopp eine Studie über die Vertreibung
der Deutschen aus den Ostgebieten herausgebracht (Die große
Flucht, Econ, 2001), und nunmehr erschien Peter Glotz, Die
Vertreibung. Böhmen als Lehrstück (Ullstein, 2003).
Als der Schriftsteller und Publizist Rafael Seligman vor kurzem
bei einem Interview gefragt wurde, ob Jörg Friedrich’s
Buch über das Leid deutscher Opfer im Bombenkrieg Tabus breche,
antwortete er. „Keineswegs. Im Gegenteil erscheint es mir notwendig,
jegliches menschliche Leid zu dokumentieren. ... Der Bombenkrieg
gegen deutsche Städte hat den Zusammenbruch des Dritten Reiches
nicht beschleunigt, er war daher ein Verbrechen. Mich stört
es, wenn man solche Erkenntnisse nicht betonen „darf“.
Natürlich dürfen wir!“ (Berliner Morgen, 30.
Oktober 2003, S. 15). Zu den Zwangsvertriebenen gehört
auch Martha Kent, deren autobiographisches Buch kurz nach dem Kriege
mit ihrer frühen Kindheit als Vertriebene aus einem polnischen
Dorf und als Insassin eines Konzentrationslagers beginnt. Nicht
Hitler, sondern die polnische Regierung ordnete diese Vertreibung
an. Die Autorin—jetzt US-Bürgerin
in Phönix, Arizona, lebend—stellt sich die literarische
Aufgabe, ihre frühen Erlebnisse von der Perspektive eines Kindes
aus darzustellen, um sie so authentisch wie möglich beschreiben
zu können. Der Antrieb zur Niederschrift war eine schwere Depression,
die auf die traumatischen Verhältnisse in ihrer Kindheit zurückzuführen
waren, und die sie zunächst in einer psychiatrischen Klinik
zu kurieren suchte. Sie unternahm ein literarisches Experiment,
das schon Christa Wolf in Kindheitsmuster Schwierigkeiten
bereitete: Kann man sich in die Psyche des Kindes, das man einmal
gewesen ist, hineinversetzen, ohne die Erlebnisse durch die Sicht,
die man als Erwachsene entwickelt hat, zu verändern? Als Psychologin,
die auch ein Studium in klinischer Neuropsychologie absolviert hatte
und beruflich Patienten mit Kriegs- und Gefangenschaftstraumata
behandelte, geht Martha Kent davon aus, daß ihre Erinnerungen
eben anders sind als solche, die sie in bislang veröffentlichten
Berichten älterer Lagerinsassen gelesen hatte. Für diese
war das Lagerleben das Anormale, das gewalttätig Schreckliche
gewesen; für sie als Kind jedoch das „Normale,“ da
sie nichts anderes kannte. Im Rückblick macht sie zwei menschliche
Grundbedürfnisse geltend, die einem Kind damals das Überleben
ermöglichten: das Anknüpfen menschlicher Beziehungen,
seien sie noch so knapp und selten, und die Freude an kleinen Dingen,
wie z.B. die im Titel ihres Buches erwähnte Porzellanscherbe,
die sie damals in einem Graben fand und sie durch ihre schöne
Bemalung erfreute. Die Liebe zu einem anderen Menschen und die gegenseitige
Zuwendung erachtet sie als lebensnotwendig. Im Kontrast hierzu bemerkt
Ruth Klüger, die ihre Kindheit im Nazi-Konzentrationslager
in ihrem Buch Weiter Leben. Eine Jugend (Wallstein Verlag
1992) beschreibt: „Doch in Auschwitz konnte die Liebe nicht
retten und der Verstand auch nicht.“ (Klüger 128), weil
dort gewissermaßen nur der Wahnsinn herrschte. Klüger
war damals jedoch als Teenager in einem Alter, in dem sie wohl schon
eine Erwachsenenperspektive, von der sich Kent absetzt, entwickelt
hatte. Die Autorin wird Anfang des 2. Weltkrieges
geboren und lebt mit ihrer Familie in dem deutsch-polnischen Dorf
Ulaski. Im Jahre 1945 müssen alle Deutschen diesen Ort verlassen,
und werden zunächst als Gefangene auf eine Farm gebracht, wo
die Eltern Zwangsarbeit verrichten müssen. Zwei Jahre danach,
im Jahre 1947, kommt die Familie in das Konzentrationslager Potulice,
wo das Kind—getrennt von ihren Eltern—Hunger, Gewalt und
Schrecken erlebt. Zu der Zeit ist Martha sechs Jahre alt. Dieser
Teil des Buches enthält die anschaulichsten und gelungensten
Kapitel ihrer Autobiographie. Der Horror des Lagerlebens enthüllt
sich in seiner Unmenschlichkeit, indem er lakonisch durch die vorurteilslosen
Augen einer Sechsjährigen gefiltert wird, die nichts anderes
kennt. Erst 1949 kommt die Familie wieder zusammen und kann nach
Westdeutschland fliehen. Als Kind ist Martha von ihrer Mutter
geprägt, die den Familienzusammenhang, die Liebe der Eltern
und Kinder über alles stellt. Als man Mutter und Kinder allein
vertreiben will, insistiert sie, lieber mit ihren Kindern erschossen
zu werden als ohne den Vater zu gehen. So besteht eine der ersten
Erinnerungen der Autorin darin, an einer Mauer darauf zu warten,
umgebracht zu werden. Sie wird nicht erschossen, aber schließlich
doch von der Mutter getrennt und in einer Kinderbaracke untergebracht.
Die Mutter, die im nahen Frauenlager eingeschlossen ist, darf sie
nur am Sonntag besuchen. Weniger als ein Drittel des Buches ist
dieser Zeit im Gefangenenlager gewidmet, die das Kind fürs
Leben geprägt hat. Kent versucht, die Nachwirkungen ihres
Lebens im Lager aufzuspüren. Zunächst schildert sie das
Leben der Familie als Flüchtinge in dem kleinen Ort Trutzhain
in Hessen. Sie sind in einer primitiven Baracke untergebracht, in
der ehemals Kriegsgefangene inhaftiert waren (das Stammlager IXa).
Marthas Zeit in der Freiheit stellt sich für sie als schwerer
heraus als das Leben in Haft. Von 1947 bis 1952 lernt das Flüchtlingskind,
daß in der Freiheit eine andere Grausamkeit herrscht. Sie
empfängt von ihren Lehrern unverdiente Schläge anstatt
der erwarteten Zugehörigkeitsgesten, die ihr in Potulice das
Überleben garantierten. Nur Einzelne, wie z.B. ein Lehrer,
stärken ihr Selbstvertrauen etwas. Die wirtschaftliche Not
bestärkt die Familie, nach Kanada auszuwandern. Dort lernt
die nun Dreizehnjährige das Leben in der sogenannten Freiheit
weiterhin fürchten. Sie erfährt als Schulkind, wie ideologische
Meinungen verletzen können. Außerhalb der Familie spürt
sie nichts von dem, was sie als Kind im Lager an Menschlichkeit
auch von Fremden erfahren hatte. Es scheint, daß alle ausländischen
Kinder, sie eingeschlossen, hier als potentielle Kriminelle, ja
Mörder gelten. Die Argumentationen der Lehrer, die sich auf
Staatsrecht und Gesetz und nicht so sehr auf Menschlichkeit beziehen,
bestätigen ihr die Ausgrenzung. Sie ist die „Andere.“ Die Autorin ist Beispiel dafür,
wie die Leidenserlebnisse nach dem Krieg Menschen geprägt haben—im
positiven wie im negativen Sinne. Sie fragt sich, wie es kam, dass
sie die lange Gefangenschaft so gut überstanden hatte und—im
Gegensatz dazu—die folgende Freiheit so schwer ertragen konnte.
Als Leser können wir ihre Entwicklung, auch wenn sie nicht
immer reflektiert ist, mitverfolgen. Sie ist empfindlicher und aufmerksamer
als es bei jungen Mädchen üblich ist, und sie entwickelt
eine Antenne für Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft. Dazu
wachsen ihre Energie und ihr Fleiß und das Bedürfnis,
ihre Fähigkeiten zu beweisen. Ihre Familie kauft einen Bauernhof
in Kanada und baut sich eine neue Existenz auf; doch sie entwächst
bald diesem engen Milieu. Ihre liebevollste Beschreibung gilt Anekdoten
über andere Immigrantinnen, die schwer arbeiten, um ihr Leben
zu fristen. Durch Zufall und durch eigene Durchsetzungskraft gelingt
es ihr, ein Studium anzufangen und in den USA ein Stipendium an
einer Universität zu erhalten. Aber auch als Studentin ist
sie weiterhin verunsichert. Dann scheint sie Glück zu haben—so
ist es im Buch dargestellt, denn sie trifft einen sehr liebenswerten
jungen Mann, den sie später heiratet und der immer noch ihr
Ehemann ist. Das Studium schließt sie mit einem Doktorat in
Psychologie ab und sie erhält einen Lehrauftrag an einem College
in Neuengland. Dieser Teil des Buches ist den Schattenseiten des
amerikanischen Universitätssystems und den paradoxen Machenschaften
der akademischen Welt gewidmet, in der Erfolg in ihrem Fall das
Scheitern nach sich zieht. Sie hält Abrechnung mit einem System,
in dem sie trotz vieler Veröffentlichungen und gut finanzierter
Forschungsprojekte keine Festanstellung erhält und ihren Beruf
verlassen muß. Nach einem Zusatzstudium in klinischer
Neuropsychologie arbeitet sie mit Kriegsveteranen im Veterans Affairs
Medical Center in Phoenix, Arizona. Die Schicksale, die ihr hier
begegnen, locken ihre eigene unterdrückte Vergangenheit hervor,
die verarbeitet werden will. Sie erlebt eine Krise, in der eine
Verquickung von Alpträumen und Realität einen normalen
Tagesablauf unmöglich macht. Sie schreibt: „Und dann war
da dieses Schweigen, beinahe fünfzig Jahre Schweigen. Ich mußte
Frieden mit dieser schwer faßbaren Last machen.“ (309)
Erst als sie nach einer Therapie im Krankenhaus anfängt zu
schreiben, kann sie langsam eine innere Ausgeglichenheit wieder
herstellen. Und das Schreiben, so bemerkt sie, ließ ihren
alten Schmerz verschwinden. „Beim Schreiben war ich in das
vergangne Leid zurückgekehrt. Aber nicht mit dem Stress wie
damals, sondern mit einer gegenteiligen Emotion – mit Empathie.
Ich hatte die positive Beziehung zu anderen ... wiederhergestellt.
Diese empathische Bindung half mir, Demütigungen zu ertragen.“
(278) Martha Kent entwickelt für sich eine Psychologie der
Empathie. Sie nimmt gern Risiken zur Rettung anderer Menschen auf
sich und gewinnt dabei erhöhte Bedeutung für ihr eigenes
Leben. Die Anstrengung der Wortfindung für
diese Lebensbewältigung hat jedoch nicht nur therapeutische
Wirkung. Martha Kent ist ein gutes Buch gelungen. Sie hat sich nicht
einfach etwas von der Seele geschrieben, sondern sie legt ein beachtliches
literarisches Talent zu Tage. Es ist keinesfalls der rein sachliche
Bericht einer Wissenschaftlerin geworden, sondern der literarische
Text einer Autorin, die erfolgreich mit der Sprache ringt, um etwas
Unaussprechliches zu artikulieren. Die Sprache wandelt sich für
sie in konkretes Erleben. Sie schreibt: „Ich kippte meine Wortschnipsel
in kleine, verschließbare Butterbrottüten... Es gefiel
mir, Worte freizusetzen, sie der Erde zurückzugeben, wo sie
sich erneuern und Teil dessen werden konnten, dem sie begegneten.“
(300-301) Die Sprachfindung und -verteilung gibt ihr im Jahre 1998
auch den Mut zu einer Reise zurück nach Potulice zu einem Treffen
mit deutschen Überlebenden aus diesem Lager und mit Mitgliedern
der polnischen Bevölkerung, bei dem Monumente der Erinnerung
für die Opfer beider Nationen eingeweiht werden. Somit gelingt
es der Autorin, ein Buch zu verfassen, das ihr eigenes Trauma heilt
und sich gegen den Haß stellt. Martha Kent bringt eine notwendige
Erinnerung an die historische Zeit des Schreckens nach dem 2. Weltkrieg
zurück, doch ohne Bitterkeit und Anschuldigungen, sondern mit
einer Geste der Versöhnung.
copyright: Glossen, Oktober, 2004
| |