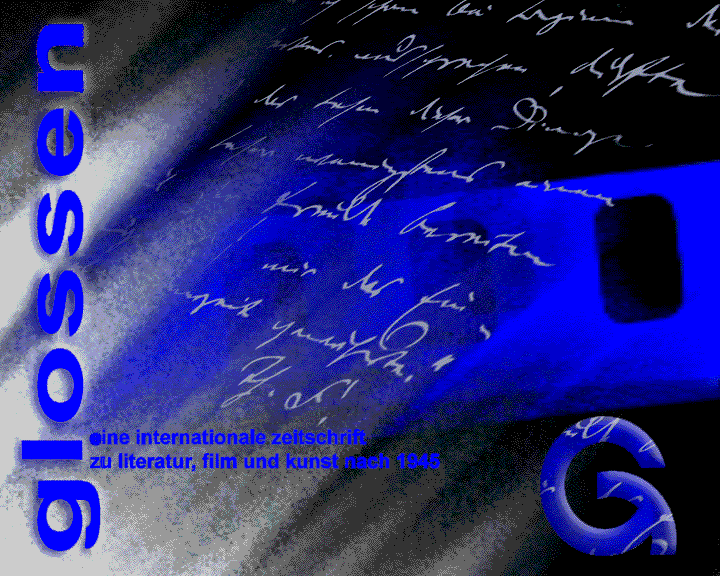|
a peer reviewed scholarly journal on literature and art in the German speaking countries after 1945 ISSN 1093-6025
published at Dickinson
College |
G l o s s e n: Rezension
Rosemarie Marschner, Das Bücherzimmer. Roman. München: Deutscher Taschenbuchverlag, 2004. 414 S.
Passend zum politischen Schwerpunktthema
der Wiener Festwochen 2004 “Februar 1934 – Das Wörterbuch
des Schweigens” erscheint im Buchhandel Rosemarie Marschners
Roman Das Bücherzimmer, in dem es um die Selbstfindung
einer Frau geht, deren Schicksal eng an die historischen Ereignisse
in Linz, Oberösterreich, von 1933 bis 1938 gebunden ist. Die
Protagonistin Marie Zweisam wird zur Augenzeugin der viertägigen
bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen zwischen dem sozialdemokratischen
Schutzbund und der groß-deutsch orientierten, konservativen
und christlich-sozialen Heimwehr im Februar 1934. Sie berichtet
über das Schicksal des Kommandanten des Schutzbundes Richard
Bernaschek und des Schutzbündlers Anton Bulgari, die Konsequenzen
der Nürnberger Rassengesetze von 1935, die Euphorie der Bevölkerung
bei den Massenkundgebungen unmittelbar vor dem Anschluß im
Jahre 1938 und dem Spatenstich zu den Hermann-Göring-Werken
1938, dem die Umsiedlungsaktion eines Wohngebietes folgte, um Platz
für ein riesiges Hüttenwerk zu schaffen und somit den
wirtschaftlichen Aufstieg der „Führerstadt Linz“
zu sichern. Obgleich fiktive Einzelschicksale Gefahr laufen, ins
Triviale abzugleiten, gelingt Marschner ein neuer Beitrag zu einem
weniger bekannten Stückchen Vergangenheit, den sogenannten
“Opfern des Fortschritts”, die kurz nach ihrem „Ja“
bei der Volksabstimmung 1938 ihr Hab und Gut durch Zwangsumsiedlungen
verloren. Marschner distanziert sich von der traditionellen Österreichkritik,
die auf NS – Kontinuitäten im Nachkriegsösterreich
beharrt, und berücksichtigt statt dessen Phänomene wie
die Konsequenzen des Verbots der NSDAP in Österreich unter
Bundeskanzler Engelbert Dollfuß und die Arbeiteraufstände
1934. Ob es ihr gelingt, einen wesentlichen Beitrag zum politischen
Verständnis jener Epoche zu leisten, mag dahin gestellt sein.
Sicher ist, daß sie es versteht, mit ihrem Panorama der Zeit
und der Stadt, politisches Interesse zu wecken und für zahlreiche
Denkanstöße zum Thema „Führerstadt Linz“
zu sorgen, wie beispielsweise die Ausbaupläne, die Adolf Hitler
für die Stadt hatte, die er zu seinem Alterssitz machen wollte.
Als weitere Lektüre seien unter anderem Gerhart Marckhgotts
“Das Projekt 'Führerbibliothek’ in Linz“ (411
– 34) und Georg Wachas “Denkmale aus der NS – Zeit”
(373 – 410) in dem Sammelband Entnazifizierung und Wiederaufbau
in Linz (1996) empfohlen. Den eigentümlichen Rahmen, den
die Autorin dem Roman verpaßt, kann man sich eigentlich nur
damit erklären, daß sie zeigen möchte, daß
hinter jeder offiziellen Geschichte eine inoffizielle steckt, die
der Nachwelt meist verborgen bleibt. Nicht die kometenhafte Karriere
der Großmutter vom Dienstmädchen zur Starjournalistin
oder ihr zweifelsohne prekäres Studium während des Zweiten
Weltkriegs stehen im Mittelpunkt des Romans, sondern Marie Zweisams
Kindheit, Jugend und erste Ehe. Ohne zu beschönigen und ohne
jegliche Sentimentalität lernt somit der Enkel, der das Begräbnis
der geschätzten Großmutter vorbereitet, eine ihm bislang
unbekannte Seite der von ihm so verehrten Verwandten kennen. Marie Zweisam, verehelichte Marie Janus
und geschiedene Marie Zweisam mußte schnell lernen, erwachsen
zu werden und stets neue Hürden zu meistern. Die alleinerziehende
Mutter Mira, die sich weigerte, zur Engelmacherin zu gehen und zudem
“in einem [ihrem] unbußfertigen Gemütszustand …niemals
versucht hatte, die eigene Schande in eheliche Bahnen zu lenken”
(26), setzte alles daran, daß ihre Tochter ein Leben in einer
“geräumigeren Welt” (178) führen kann. Wie im
Werbeslogan “In Linz beginnt’s” bietet sich Marie
die vielversprechende Gelegenheit, “in den Dienst” bei
einer wohlhabenden Linzer Familie zu gehen. Paradoxerweise ist dies
tatsächlich ein erster Schritt zur Selbstständigkeit,
denn im Bücherzimmer ihrer Dienstgeber in der Villa Horbach
spielt sich ein tägliches Ritual ab: Marie muß dem pensionierten
Notar sorgfältig markierte Artikel aus der Tagespresse vorlesen:
“Und Marie las. Es war die schönste Stunde des Tages.
Die einzige, in der sie sich bei dem Klang der eigenen Stimme ihrer
selbst bewußt wurde. Sie hörte und fühlte sich selbst.
Sie war sie selbst, auch wenn sie zu Anfang nur einen Bruchteil
dessen verstand, was sie vortrug” (59). Obgleich dem Lesen
keine Diskussion folgt, außer dem sporadischen Kommentar des
Notars, liest Marie heimlich abends die Zeitung in der Mädchenkammer
und bereichert ihr Leben mit einer weiteren Errungenschaft –
einem Leseheftchen der Stadtbücherei Linz. Die Autodidaktin
plädiert für ein intensives Beschäftigen mit Tagespolitik,
um sich ein subtiles politisches Bewußtsein anzueignen, weg
von den “Herz – Schmerz” Schlagzeilen der Lokalnachrichten.
Klassisches Bildungsgut, und zwar William Shakespeares Der Sturm
wurde der Mutter zum Verhängnis, die inspiriert durch die Liebesgeschichte
von Ferdinand und Miranda ihrer eigenen Leidenschaft freien Lauf
ließ. Lebenslängliche Verachtung war der Preis für
ihren Fehltritt – ein Fehltritt, der wiederum die Partnerwahl
der Tochter stark beeinflußte. Die Zäsur in Maries Leben trat
allerdings nicht durch die schicksalhaften Straßenschlachten
und den Generalstreik 1934 ein, sondern durch den frühen Tod
der Mutter und die unmittelbar folgende überstürzte Ehe
mit dem Bäcker Franz Janus. Ihr bisheriges Außenseiterdasein
als Kind einer alleinstehenden Mutter in der Dorfgemeinschaft sowie
als Dienstmädchen in einer großbürgerlichen Familie
tauschte sie nun gegen das “Bewußtwerden der Einseitigkeit
und der Begrenzung auf das Eigene” (238) im Kleinbürgertum.
Perfekt spielte Marie ihre Rolle als adrettes, tüchtiges Rädchen
im Getriebe der Bäckerfamilie Janus, obwohl sie es allmählich
leid war, in immer neue Rollen zu schlüpfen. In ihrer Ehe dominiert
die ehrgeizige, gewinnsüchtige, statusbewußte Schwiegermutter,
die über Leichen geht, um ihre Ambitionen durchzusetzen, ihren
Geschäftssinn mit Mildtätigkeit kaschiert und sich voll
und ganz der neuen Ideologie verschreibt, die an das Hakenkreuz
glaubt. Marie hingegen bleibt eine Außenseiterin, nicht zuletzt
wegen ihrer politischen Ansichten, die dem nationalsozialistischen
Zeitgeist widersprechen. Sehr anschaulich erfaßt Marschner
das Bild jener Zeit: “den Untergang eines kleinen Staates,
mit dem keiner mehr so richtig etwas anfangen konnte” (139),
den Blick ins Nachbarland, wo Wohlstand und Ordnung herrschte und
Arbeit für alle war, den Judenboykott, den “Rausch der
Menge” (289), den Doppelselbstmord zweier Brotkunden (307),
das Verbot der Ironie als jüdischer Eigenschaft (312), die
Werbeslogans “Bis in den Tod – Rot – Weiß –
Rot!” (288) gekontert vom Propagandafeldzug “Gemeinsames
Blut gehört in ein gemeinsames Reich!” (289) sowie arisierte
Geschäfte wie das bekannte Kaufhaus Kraus und Schober der Familie
Weiß am Hauptplatz. Unwissend und unbefangen wird Marie auch
Zeugin vom assimilierten Judentum, wenn sie beispielsweise bei Familie
Ohnesorg “ein riesiges Gesteck aus Tannenreisig […], das
um einen großen Leuchter drapiert war” (262) für
einen zweiten Christbaum hält. Marschners Bilder der Zeit ergeben auch ein eindrucksvolles Porträt der Stadt an der Donau und wirken als Kommentar zu Fritz Mayrhofers Bildband Linz in alten Fotografien. Der historische Bilderbogen reicht vom bunten Markttreiben am Hauptplatz, dem ehemaligen Franz-Josef-Platz und späteren Adolf-Hitler Platz, der geschäftigen Landstraße mit der „Tramway“, dem bewaffneten Widerstand am 12. Februar 1934 im Hotel Schiff (heutige SPÖ Landesparteizentrale), der wechselhaften Geschichte des Hotel Weinzinger, den Parkanlagen Hessenplatz und Volksgarten, über die Urfahraner Wäscherinnen zu den Bettlerautomaten und schließlich einem der Wahrzeichen der Stadt, dem Pöstlingberg. Das dynamische Verhältnis zwischen
Innen – und Außenwelt wird durch Kontraste wie Stadt
– Land oder arm - reich definiert. Während man im heimatlichen
Dorf die Außenwelt als Bedrohung und die Städter als
Eindringlinge sah, die den Bauern Schmuck gegen Lebensmittel tauschten,
lebte man in St. Peter nach draußen und schätzte die
Nähe zur Stadt, aus der man Profit schlug. Als Dienstmädchen
erlebte Marie, wie sich das Großbürgertum durch schattige
Alleen vor “dem Geschrei der Straße” schützte.
Konventionen und hohe soziale Kontrolle zeichnen ihr Heimatdorf
in der Nähe von Wels aus, in dem jeder nach strikten Regeln
zu leben hat. Andererseits gibt das Dorf auch Schutz, besonders
in wirtschaftlicher Hinsicht, da hier im Winter niemand zu frieren
braucht. Die Landeshauptstadt Linz hingegen bietet Anonymität
und ermöglicht erste Gehversuche. Problemlos fügt sich
Marie ins Stadtgefüge, sowohl als Dienstmädchen auf ihren
Botengängen wie auch als elegant gekleidetes Mädchen an
ihren freien Nachmittagen, ohne jedoch tatsächlich Zugang zur
Stadt zu finden. Erst aus der Vogelperspektive vom Pöstlingberg
ist sie von Linz entzückt, und richtig zu Hause fühlt
sie sich, als sie mit dem Lieferwagen kreuz und quer in der Stadt
Brotkunden beliefert. In die Großstadt Wien fährt sie
zur Hochzeitsreise, zum Studium und um Karriere zu machen, bei der
ihr schließlich als Journalistin die Außen(seiter)perspektive
zugute kommt. Der vielleicht interessanteste Teil
des Romans beschäftigt sich mit dem Schicksal des idyllischen
Dorfes St. Peter: Tür an Tür wohnen hier skrupellose Nutznießer
des Regimes und der Rassengesetze, die sich an arisiertem Judenvermögen
bereichern, wie Maries Schwiegermutter, und die “Opfer des
Fortschritts”. Nachdem am 13. Mai 1938 der Spatenstich zu den
Hermann-Göring-Werken stattgefunden hatte, begannen im Juni
die ersten Umsiedlungen: “4500 Menschen sollten fortgeschickt
werden, 946 Häuser niedergerissen. Ein junger Anwalt, noch
keine dreißig, sei gekommen, ein gewisser Dr. Meissner….
Im Auftrag der Regierung kaufte er Haus um Haus” (353 - 54).
Plötzlich stellen diese Familiendramen das Schicksal der in
die Emigration gezwungenen jüdischen Familie Ohnesorg in den
Schatten, die es sich ja angeblich im milden, sonnigen Klima gut
gehen ließ. Auch für die geplanten Ersatzwohnungen auf
dem Keferfeld am Stadtrand von Linz mußten prächtige
Bauernhöfe enteignet und abgerissen werden. Wiederum bringt
Marschner die offizielle Version der Geschichte ein: “Wer nicht
an Ort und Stelle die Wahrheit erlebte, mußte glauben, am
Rande von Linz würde ein Wunderwerk der Technik errichtet:
auf Brachland, das nur darauf gewartet hatte, endlich im Sinne der
Reichsbevölkerung genutzt zu werden” (403). Der Roman liest sich gut und flüssig
und verzichtet auf Schnörkel. Die strikte, konsequente Linearität
wird nur in Ausnahmefällen durch Träume oder Erinnerungen
unterbrochen. In einem dieser Träume begegnet Marie ihrem Vater,
und wie in der Realität bei einer Dinnerparty im Hause Horbach,
erkennt er die Tochter nicht. Auffallend sind die Dingsymbole als
Bindeglieder zwischen Maries verschiedenen Welten. Die “Linzer
Augen”, die Marie bei ihrem ersten Ausgang als Dienstmädchen
im Schaufenster einer Konditorei entdeckt (38), erinnern sie sofort
an das Dorf und an ihren Mentor, den Lehrer. Das generationsübergreifende
Dingsymbol ist die Melodie “Schlaf, mein Liebling”, die
der Geliebte der Mutter ins Ohr summte, die die Tochter für
die Mutter kurz vor ihrem Tod im Radio spielt und die schließlich
der Enkel summt. Diese Erinnerungen an eine frühere Welt treiben
die Handlung förmlich voran. So als müßte man gewisse
Lebensabschnitte noch einmal in der Erinnerung oder in der Phantasie
durchspielen, um sich dann davon zu befreien, als könne man
Schicht um Schicht einer Vergangenheit abtragen, um allmählich
zu sich selbst zu kommen. Gleichzeitig bieten die Dingsymbole eine
Alternative zu den kulinarischen und musikalischen Exportartikeln
Österreichs, wie Sachertorte und Johann Strauß. Marschner inszeniert einen wahren Reigen
von Charakteren, um die verschiedenen politischen Positionen aufzuzeigen.
Vertreten sind das weibliche NSDAP Mitglied (ihre Schwiegermutter),
die Mitläufer (ihr Mann und ihr Schwiegervater, der sich darauf
spezialisiert hat, Charakterzüge von Größe und Form
der Ohrläppchen abzuleiten), die assimilierte jüdische
Familie Ohnesorg, der pensionierte Notar (in der Familie ihrer Dienstherren),
der die Ereignisse und Gefahren richtig einschätzt, aufgrund
seines hohen Alters aber nichts dagegen unternimmt. Dennoch wirkt
die breite Palette der Charaktere forciert, denn statt komplexer
Entwicklungen stößt man allzu oft auf stereotypische
Darstellungen, besonders bei den Frauen: Marie verliert nie den
Hauch vom Aschenputtel als inkognito Prinzessin; das verwöhnte,
höhere Töchterchen erklärt mit Stolz, kein Buch aufzuschlagen;
die gnädige Frau Horbach hofft, daß radioaktive Schönheitssalben
ihr ewige Jugend schenken und lebt ihren Frust in wilden Einkaufstouren
aus; die ewig geächtete Mutter Maries wird erst wieder durch
ihr Begräbnis in die Dorfgemeinschaft integriert; die plumpen
Bauernmädchen unterdrücken ihr sexuelles Erwachen mit
katholischer Keuschheit; Amalie, die ältere Wirtschafterin
der Horbachs, zieht den Freitod dem Abgeschobenwerden aufs Land
zu den Verwandten vor; Cäcilia wird wegen ihrer Unfruchtbarkeit
verächtlich eine Steingeiß genannt. Moral oder Anklage liegen dem Text
ebenso fern wie spannende ästhetische Konstruktionen. Vielmehr
erzählt die Autorin, wie es gewesen sein könnte. Interessant
ist auch die Frage nach dem Titel Das Bücherzimmer.
Würde denn der Roman im schnellen Medium der Zeitung von der
Protagonistin selbst gelesen werden? Wenn Marie Joseph Roths Radetzkymarsch
aus der Bücherei leiht, liegt der Vergleich zu monumentalen
Zeitromanen wie Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften
oder Heimito von Doderers Die Strudelhofstiege oder Melzer
und die Tiefe der Jahre nahe. Rosemarie Marschners Das Bücherzimmer
wird ihnen wohl kaum den Rang streitig machen. Dennoch schlägt
man als aufmerksame Leserin das Buch zufrieden zu mit dem Gefühl,
ein Stückchen jener Seite von Linz mitbekommen zu haben, die
nicht allen bekannt sein dürfte, und (wie der Enkel im Roman)
möchte man dann gerne mehr wissen.
| |