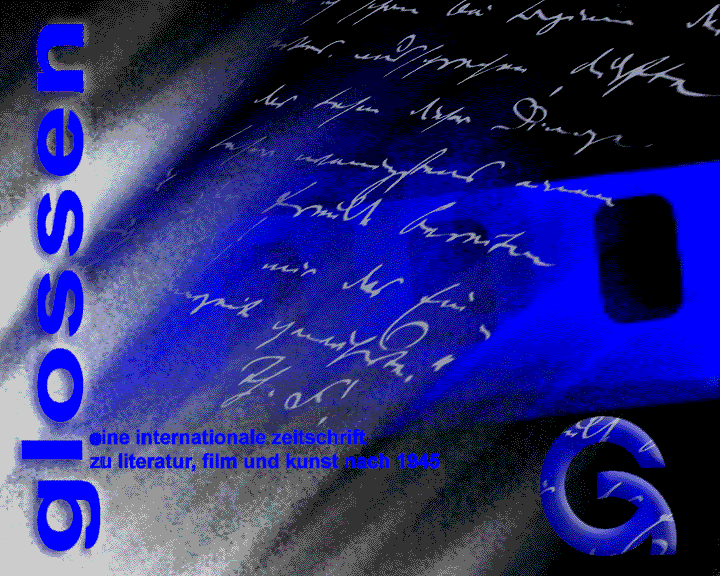|
a peer reviewed scholarly journal on literature and art in the German speaking countries after 1945 ISSN 1093-6025
published at Dickinson
College
|
Glossen 21- Artikel
Die DDR als Absurditätenshow -- Vom Schreiben nach der Wende Daniel Sich Im Sozialismus wurde viel gelacht, berichtet Stefan Wolle in seiner Herrschafts- und Gesellschaftsgeschichte der DDR: „Die grotesken und lächerlichen Züge des Realsozialismus waren nicht zu übersehen und wurden auch niemals übersehen."[1] Mit seiner Einschätzung, die der Historiker mit bildhaften Beschreibungen aus dem realsozialistischen Alltagsleben anzureichern weiß, läge Wolle auch für die Nachwendezeit noch richtig: Es hat etwas Heiteres bekommen, von der DDR zu erzählen, nachdem es sie nicht mehr gibt. Jüngstes Beispiel für diese Entwicklung ist der außerordentlich erfolgreich gelaufene Film Good bye, Lenin! (2003) von Wolfgang Becker, dessen Komik sich zu guten Teilen aus den Ereignissen der jüngeren deutschen Geschichte speist. Er erzählt die Geschichte einer staatstreuen DDR-Bürgerin, die im Wendeherbst ins Koma fällt und die historischen Ereignisse buchstäblich verschläft. Der Zuschauer freut sich, immerhin stellte Immanuel Kant schon vor über 200 Jahren fest, Lachen sei „ein Affekt aus der plötzlichen Verwandlung einer Erwartung in nichts."[2] Becker steigert die komische Fallhöhe noch, indem er den Arzt eine folgenschwere Prognose stellen lässt: Die herzschwache Patientin werde die Nachricht vom Ende „ihrer DDR" nicht überleben. Also muss im Schlafzimmer der glücklich Erwachten eine nicht enden wollende Komödie aufgeführt werden: die Fortsetzung der DDR als Kammerspiel. Eine DDR, die mit zunehmendem Abstand immer skurriler wird, kann auch in der ostdeutschen Literatur der neunziger Jahre beobachtet werden. Dieser Beitrag stellt verschiedene literarische Erscheinungsformen des Komischen vor, um sich kritisch mit ihnen auseinander zu setzen. Die These lautet: Eine humoristische Darstellung von Gegenwart und Vergangenheit mag unmittelbar entlastend wirken, die literarische Qualität dieses Humors ist jedoch im Einzelfall fragwürdig. Ein wichtiger Kopf in dieser Erfahrungsgemeinschaft war ungeachtet seines gehobenen Alters der Dichter und Erzähler Adolf Endler. Er wurde jüngst gefragt, ob er das Schreiben nach der Wende als schwieriger empfunden habe. Seine Antwort bietet eine umfassende Beschreibung des Selbstverständigungsprozesses ostdeutscher Autoren nach 1989: „Na ja, ich hatte mich ganz gut eingespielt auf diese spezielle Absurditätenshow, die mir die DDR geboten hat. Meine Erzählmethoden waren eingerichtet auf diesen verrückten Staat, auf diese für mich immer abstruser werdende DDR. Und als die wegbrach, geriet natürlich auch mein literarisches Spiel durcheinander. Ich habe wie fast alle sogenannten DDR-Schriftsteller 1989 große Schwierigkeiten mit dem Schreiben bekommen. Ich konnte auf die neuen Verhältnisse nicht mit den gleichen Mitteln eingehen. Ich habe dann ernster geschrieben oder auch noch verrückter, habe verschiedene Wege gesucht. Ich suche eigentlich immer noch."[3] Endler erwähnt zentrale Momente der Krise: die Wahrnehmung einer Zäsur, das Gefühl des Nicht-mehr-so-Schreiben-Könnens, die Suche nach anderen Schreibweisen. Diese Situation wurde von allen Schriftstellern erfahren, ob sie die DDR bereits verlassen hatten oder dort geblieben waren. Zehn Jahre nach dem Mauerfall hat sich mit Jan Faktor ein weiteres Mitglied der Prenzlauer-Berg-Szene an eine erklärende Nachbetrachtung herangewagt. Unter dem provozierenden Titel „Warum aus uns nichts geworden ist" zieht er eine Linie vom rebellischen Gestus der achtziger Jahre bis zu jüngeren Veröffentlichungen aus dem Umfeld der ehemaligen Szene-Dichter. Diese Texte seien „schwer lesbar bis ungenießbar", so Faktor. Seine Diagnose: „Man will sich im Grunde nicht mitteilen."[4] Dabei gibt es eine ganze Reihe von Autoren - Faktor selber nennt u.a. Thomas Brussig und Jens Sparschuh, wir ergänzen Kerstin Hensel und Katja Lange-Müller, die ihre Verweigerungshaltung ablegen konnten und sich seitdem durchaus mitteilen wollen und können. Ihre Texte erlauben es, die Tendenz zu einem humoristischen Erzählen von der DDR näher zu betrachten. Nun ist unbestritten, dass Literatur viel zur Entwicklung einer Erinnerungskultur beitragen kann. Wo ein System und mit ihm eine Kultur und Lebenswelt von der Bildfläche verschwunden ist, betätigt sich der Schriftsteller als Hüter kollektiver Erinnerung. Dabei bewegt er sich zwischen zwei divergenten Polen: entweder versucht er jener Tendenz zur Verklärung und Verdrängung der DDR-Realien das wirklich gelebte Leben entgegenzustellen oder aber er leistet ihr - etwa unter ironischem Hinweis auf sein „schlechtes Gedächtnis" - weiter Vorschub. Aber kann Literatur tatsächlich „Das Vergängliche überlisten?", wie 1996 ein Band mit Selbstbefragungen meist ostdeutscher Autoren im Titel fragte? Kurt Drawert, der seit 1993 in der alten BRD lebt, mahnt an dieser Stelle zur Vorsicht: „Die Eliminierung der Verhältnisse eliminiert noch nicht die ins Innere der Menschen eingegangene Struktur, unter der sie einst standen".[6] Mit seinem nachfolgenden Plädoyer für das öffentliche Reden über die verschwundene DDR formuliert Drawert zugleich eine kurze Poetik der Nachwendeliteratur. Es gebe zwei wesentliche Verdienste der vorsätzlichen Auseinandersetzung: „[D]ie Bedrückungen unserer Herkunft nicht aus dem Bewußtsein zu lösen und diese Notwendigkeit des Erinnerns erscheinen zu lassen auf dem Hintergrund der Welt - denn die Probleme der Welt verkleinern sich nicht auf das Maß dieser verschwundenen DDR und ihrer historischen Viertelstunde." Freilich wird die Aufgabe eines Schriftstellers somit nicht ganz ohne Anspruch gedacht. Die Frage lautet demnach: Welchen Beitrag können ostdeutsche Autoren zum aktuellen Diskurs über die DDR-Vergangenheit und die Entwicklung im vereinten Deutschland leisten? Die Erinnerungsarbeit haben beide Autoren nachdrücklich aufgenommen. Aber wie gut vertragen sich ernstes Anliegen und humoristische Verpackung? Kann ein Buch zugleich „Bretterknaller" sein und Anlass für eine Debatte, in der das Versagen einer ganzen Gesellschaft zum Thema wird? Und fördert nicht die ökonomische Unsicherheit eine Bereitschaft beim Autor, die Bedürfnisse des Marktes zu bedienen (und bekanntlich waren sämtliche DDR-Autoren von dem Zusammenbruch institutionell und ähnlich gearteter Sicherheiten betroffen)? Das Publikum goutiert humoristisches Schreiben. Dazu noch einmal Lange-Müller: „Komik finde ich enorm wichtig, weil es was mit diesem Physischen zu tun hat. Sobald der Leser mal gelacht hat, sobald mal eine richtige Reaktion kommt, hast du ihn."[9] Doch bleibt der Umgang mit humoristischen Darstellungsweisen eine heikle Angelegenheit. Im Prozess der ästhetischen und politischen Neuorientierung verbinden sich andere Schwierigkeiten damit als unter den Bedingungen einer Diktatur. So kann ein Festhalten an den listigen Formen der oppositionellen DDR-Literatur heute als Fehler gelten. Dies führt uns zu der wichtigen Frage, woran das Gelingen von literarischem Humor überhaupt gemessen werden kann. Aber ungeachtet der berechtigten Einwände, die Kraus für seine Polemik einstecken musste, enthält dieser Aufsatz auch eine überzeugende Kritik des unangebrachten und falsch eingesetzten Humors. „Was will ein Humor", fragt Kraus mit ätzendem Spott, „der unter Tränen lächelt, weil weder Kraft zum Weinen da ist noch zum Lachen?" (S. 39) Diese kraftlose Form entsteht, wenn der Witz auf Kosten der literarischen Substanz geht. Unter den spezifischen DDR-Bedingungen konnte der Macht des Staates die Subversivkraft komischer Dichtung entgegen gesetzt werden, ein Konzept also, von dem man sich eine mentale Befreiung aus den engen gesellschaftlichen Verhältnissen erhoffte. Humoristische Formen können auch in Zeiten des Umbruchs eine befreiende Wirkung hervorrufen, jedoch erfordern zum Beispiel ironische oder satirische Stilmittel eine genaue Wahrnehmung des eigenen Standortes. Wenn alte Bilder verblassen und neue aufleuchten, muss der Autor sich über seine spezifische Deutung der Gegenwart im Klaren sein, andernfalls gerät seine humoristische Schreibweise zum Ablenkungsmanöver. Mit phonstarker Komik und ätzendem Spott wird dann das Fehlen einer konsistenten Position übertönt. Auch vollendete Kalauerkunst lenkt auf Dauer davon ab, in tiefere Bewusstseinsschichten zu dringen. Ohne erneute Selbstverständigung des Autors droht das fröhliche Gelächter in ein schiefes Grinsen zu münden. Diese These lässt sich durch die Analyse einiger Werke stützen, die wir in dieser Hinsicht als beispielhaft ansehen. Doch viel zu häufig schielt der Autor dieser Späße auf ein einverständiges Lachen des Lesers, ohne dass hinter den ursächlichen Scherzen ein tieferer Sinn zutage treten würde. Maßgeblich ist dabei die Technik der komischen Inkongruenz. So begegnen immerzu Begriffe und Formulierungen, die fremden Disziplinen entliehen und anschließend in eine unpassende Beziehung zum eigentlichen Kontext gesetzt worden sind. Dieses Prinzip steuert auch die zahlreichen intertextuellen Verweise auf die Bibel und Defoes Robinson Crusoe. Dazu kommt noch eine signifikante Vorliebe für antikapitalistische Kalauer. In diese Richtung weisen Lernbroschüren, die in der Vertretersprache als „Frontberichte" (S. 56) geführt werden, oder Werbeparodien, mit denen Reklamebotschaften lächerlich gemacht werden sollen: „[E]in Duft, der Hunde provoziert!" (S. 126) Das Ende des Romans verheißt den Aufbruch in eine bessere, selbst bestimmte Zukunft. Da der Autor zuvor alle Register gezogen hat, um ein komisches Bild von seinem tragischen Helden zu entwerfen, befremdet die plötzliche Rücknahme der humoristischen Elemente. Missglückt erscheint auch die Anlehnung an Heinrich Bölls zeitkritischen Roman Ansichten eines Clowns (1963); wo Bölls Protagonist an der bürgerlichen Gesellschaft leidet und im Kleinbürgertum eine positive Alternative findet, scheitert Sparschuhs Held in erster Linie an sich selbst. Die Befreiung des Protagonisten aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit vollzieht sich am symbolträchtigen Neujahrsmorgen. Kleinbürgerliche Werte - Ideale, Ernst und Seele - bieten ihm wieder Orientierung, sein neues Vorbild ist der hilfsbereite Obdachlose Mario: „Schließlich ging der einer geregelten Beschäftigung nach, da hatte er gar keine Zeit sich dumme Gedanken zu machen, sich das Maul über andere zu zerreißen." (S. 158) Obdachlosigkeit erscheint hier als heilsame Grenzerfahrung, die ein aus dem Gleis geratenes Leben wieder in festere Bahnen lenkt. Auch in Kerstins Hensels Erzählung Tanz am Kanal (1994) findet die Ich-Figur im sozialen Abseits wieder zu sich selbst. Gabriela von Haßlau, die aus der Erzählergegenwart auf eine mühsame Sozialisation unter DDR-Bedingungen zurückblickt, lebt nach der Wende unter einer Brücke am Kanal. Auch sie hält strikt an einer kleinbürgerlichen Werteordnung fest: „Gutes Gefühl, gearbeitet zu haben."[12] Erzählt wird dieser düstere Schelmenroman in einer nüchternen Sprache, die mit Sarkasmus und grotesken Zügen angereichert ist. Dabei sind es leise Zwischentöne, in denen die Verletzungen der Protagonistin am Glaubwürdigsten ausgestellt sind. „Es geht, sage ich, aber es geht nur, weil ich schreibe." (S. 17) Die Ich-Erzählerin will kein Opfer sein, und diese Haltung ist repräsentativ für ihren Sprachgestus. Wie schnell der Anspruch auf das Eigene in Aggressionen gegen das „Andere" übergehen kann, zeigt der Auftritt von zwei West-Journalistinnen, der zur symbolischen Abrechnung mit dem Westen gesteigert ist. Zielsicher bemächtigen sich die eleganten und selbstbewussten Frauen der verwahrlosten Gabriela, was die Erzählerin bitter-ironisch ausschmückt: „Ihr Rachen speit Parfum Nr. 5 von Chanel, der lila Ledermantel fliegt und die silbernen Siegelringe sagen: Keinen Widerspruch!" (S. 78) Dabei sind die Fragen der Journalistinnen voreingenommen („Haben sie Tätowierungen? Nein? Schade", S. 80) und Gabrielas Geschichte wird falsch durch gestellte und später retuschierte Fotos („schauen Sie, wie Sie immer schauen: gekränkt, geknickt, gefoltert"). Zuletzt übt der zeitweilige Wohlstand noch eine korrumpierende Wirkung aus: „Noch besitze ich gar nichts, schon trete ich anders das Leibnitzer Katzenkopfpflaster. Vornehm, stolz, in schwarzen schweren Soldatenstiefeln." In diesem einseitigen Bild des Westens haben selbst Hinweise auf den deutschen Faschismus noch einen Platz. Für dieses Erzählen bietet Bachtins These von der Karnevalisierung der Literatur in Zeiten epochaler Umbrüche eine Grundlage. Im Karneval werden Sozial- und Werteordnungen auf den Kopf gestellt, heilige Texte und Rituale parodiert und jegliche feste Strukturen negiert. In Helden wie wir sind es die sozialistische Ideologie, das Ministerium für Staatssicherheit, die oppositionelle DDR-Elite und der Mythos des sich selbst befreienden Volkes, die einer karnevalesken Degradierung unterzogen werden. Der pubertierende Held wird von einer Sexbesessenheit ergriffen, die nicht nur die Handlung an zentralen Momenten begründet, sondern zur Methode gesteigert ist, die Gesellschaft unter sexuellem Aspekt zu betrachten: „Über die Stasi durfte ich nichts ausforschen, um meine Eltern nicht ins Gefängnis zu bringen - also befaßte ich mich mit Sex."[13] Dieser Beschluss bietet dem Erzähler alle Möglichkeit zu derb-komischer Ausgestaltung, was er mit wildem Erfindungsgeist und obszöner Metaphorik wahrnimmt: „[I]ch wollte tief hinunter in die Grotte der Abarten des Geschlechtslebens! Es mit meiner forschenden Fackel ausleuchten!" (S. 245) Nun zeichnet sich jedes Karnevalsbild durch seine unbedingte Ambivalenz aus. Das Karnevalslachen ist niemals einseitig ausgerichtet, wie Bachtin eindringlich betont, sondern es „umfaßt beide Pole des Wechsels, bezieht sich auf den Prozeß des Wechsels selbst, auf die Krise."[14] Hier stört der sozialpädagogische Anspruch des Autors. Zu deutlich zeigt sich Brussigs Gesicht hinter der Maske des Ich-Erzählers, wenn die Ereignisse wiederholt mit erläuternden Passagen kontrapunktiert werden, z.B.: „[I]ch weiß, das wir Ostdeutschen uns und der Welt noch eine Debatte schuldig sind." (S. 312) Neben einer fröhlichen Entgrenzung des Erzählten zielt Brussig auf Eindeutigkeit ab. Zur vollständigen Erlösung der Groteske im Karnevalesken, bei der die grotesken Momente Träger einer positiv konnotierten Ambivalenz sind, kann es daher nicht kommen. Anders stellt es sich in den Büchern von Katja Lange-Müller dar.[15] Sie hat zu einer Form des grotesken Erzählens gefunden, der Bachtins Theorie eine eigenständige Sinngebung erschließt. Das Karnevalesk-Groteske bezieht alles Erhabene, das nach Autorität und Respekt verlangt, auf seinen materiell-leiblichen Grund zurück, wodurch es zugleich einer Degradierung unterzogen und seiner Erneuerung zugeführt wird. Diesen Weg beschreitet Lange-Müller; sie schildert Ungewöhnliches auf alltägliche Weise und umgekehrt wird Alltägliches in ihrer Prosa entgrenzt. Wo Brussig die Verirrungen einer ganzen Gesellschaft in die Figur seines Helden projiziert, wird bei ihr der Einzelfall geschildert, gleichwohl nicht ohne den Anspruch, Gültigkeit über die Fallgeschichte hinaus zu erzielen. Die zweiteilige Erzählung Verfrühte Tierliebe (1995) entfaltet anhand weniger Tableaus die Geschichte eines Gewordenseins, der schmale Roman Die Letzten - Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei (2000) setzt diese von hinten erzählte Biographie fort. Ihre Helden und Ich-Figuren sind allesamt von einer Situation tief greifender Veränderung berührt. Ob eine unglückliche Liebe oder ein missglückter Diebstahlversuch im Kaufhaus - immer trifft die Ich-Figur auf Strukturen, die fremd und autoritär sind, bisweilen sogar unheimlich. Die Erzählstimme antwortet auf diese Zumutungen mit einer karnevalesken Frechheit, der jede Form von Tragik fremd bleibt, auch wenn dies mit einem Rückzug auf kindliche Denk- und Verhaltensmuster einher geht. So versucht sich die junge Frau in Servus, dem zweiten Teil von Verfrühte Tierliebe mit einer bockigen Haltung der Abführung durch einen Warenhausdetektiv zu entziehen. Obwohl sie „wie das in den Felsen gehauene Relief des störrischen Esels" dagegenhält, kann der Detektiv sie „kraft seines glitschigen Patschehändchens" überwältigen.[16] Die exzentrische Situation ist hier geprägt von Verfahren der karnevalistischen Übertreibung. Der ironische Gegensatz zwischen den erzählten Begebenheiten und ihrer Versprachlichung durch die Ich-Figur zeitigt eine befreiende Wirkung. Der schmale Roman Die Letzten führt mit größter Genauigkeit in eine privatwirtschaftliche Nische zurück, Udo Posbichs Satz- und Druckereibetrieb, und erweckt dabei mit sprachlichen Mitteln ein Milieu zu neuerlichem Leben, wie es heute nicht mehr existiert. Das sich ankündigende Ende einer Technologie und seine Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen reflektieren die historische Umbruchsituation 1989/90. Erzählt wird dies auf der Folie eines mehrfachen Verlustes: verschwunden ist die Welt der Setzer und Drucker, verschwunden auch der gesamte Staat, in dessen Hauptstadt die verwickelte Geschichte Ende der siebziger Jahre ihren Lauf nimmt. Posbichs Laden offenbart sich rasch als Sammelbecken verschrobener Außenseiter. Hier ist die Ich-Person unter ihresgleichen: die Drucker, Hand- und Maschinensetzer sind keine überzeugten Oppositionellen, aber Individualisten, die aus unterschiedlichen Gründen aus dem Raster des System heraus gefallen sind. Die Ich-Erzählerin erinnert sich: „Wir kamen mir vor wie Vogeljunge, die, seit sie geschlüpft waren, jedes für sich und gegen die anderen um die Raupen gekämpft hatten, die Der Große Schnabel brachte. Bis, ja bis etwas Unsichtbares, aber womöglich noch Mächtigeres, sie alle zusammen aus dem Nest kippte."[17] Umso mehr man sich in dieses unglaubliche Erzählen einlässt, umso stärker entpuppt sich der Roman als ein einziges, großes Spiel mit dem Leser. Autobiographische Spuren der Autorin irrlichtern durch den Text, Hinweise erscheinen, die auf eine wirkliche Begebenheit hindeuten; daneben steht die Inkompetenz der Ich-Erzählerin, ihre Wortgefechte mit den anderen Figuren. Der Leser dieses literarischen Verwirrspiels muss sich allerdings nicht zwischen den divergenten Darstellungen entscheiden. Er kann ihnen mit dem ambivalenten Lachen des Karnevals entgegen treten, einem Lachen, das alles Bestehende und Feste in Frage stellt - und vielleicht noch die beste Antwort darstellt in einer Zeit großer Veränderungen. Doch auch dieses Lachen bietet keine dauerhafte Gegenposition zur bestehenden Ordnung an. „Nicht von ungefähr löst der Karneval normalerweise keine Revolution, keine bleibende Umwälzung der Verhältnisse aus."[18] Was ostdeutsche Autoren zum aktuellen Diskurs über die DDR-Vergangenheit und die Entwicklung im vereinten Deutschland beitragen, muss zu großen Teilen als eine Form der Selbstvermittlung gesehen werden. Um sich angesichts der neuen Realitäten im Schreiben wieder entdecken zu können, wird noch einmal von den alten Dingen geredet. Die mit Schwierigkeiten beladene Kategorie des Komischen, dies haben wir zu zeigen versucht, sollte dabei nicht für den Königsweg zur literarischen Reaktion auf die neuen Verhältnisse gehalten werden. 2 Immanuel Kant, „Kritik der Urteilskraft". Werkausgabe. Hrsg. von Wolfgang Weischedel. Bd. 10 (Frankfurt/M.:Suhrkamp, 1974) 273. 3 Adolf Endler, „Ich bin korrumpierbar" Freitag 24. August 2001. 4 Jan Faktor, „Warum aus uns nichts geworden ist. Betrachtungen zur Prenzlauer-Berg-Szene zehn Jahre nach dem Mauerfall." DDR-Literatur der neunziger Jahre. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold (München: Ed. Text und Kritik, 2000) 92-106, hier: S. 97, 100. 5 Thomas Brussig, Am kürzeren Ende der Sonnenallee (Berlin:Volk und Welt, 1999) 156. 6 Kurt Drawert, „Ein Wort voraus", Das Vergängliche überlisten? Selbstbefragungen deutscher Autoren. Hrsg. von Ingrid Czechowski, (Leipzig:Reclam, 1996) 9-12, hier: S. 10, 12. 7 Thomas Brussig, „Wer saß unten im System? Icke!" Die Wochenpost 21. September 1995. 8 Zitiert nach Volker Hage, „Deutsche Literatur. Liebe im Gästehaus der DDR", Der Spiegel 16. Oktober 2000. 9 Katja Lange-Müller, „... dass es etwas gab, was diese Blondine zum Flennen gebracht hat." Der Deutschunterricht 53.5 (2000): 364-369. 10 Karl Kraus, „Heine und die Folgen", Polemiken, Glossen, Verse und Szenen. Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Joachim Pötschke. 2., erweiterte Auflage (Leipzig:Reclam, 1978) 19-43, hier: S. 37. 11 Jens Sparschuh, Der Zimmerspringbrunnen. Ein Heimatroman (Köln:Kiepenheuer und Witsch, 1995) 25. 12 Kerstin Hensel, Tanz am Kanal. Erzählung (Frankfurt/M.:Suhrkamp, 1994) 37. 13 Thomas Brussig, Helden wie wir. Roman (Frankfurt/M.:Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1998) 80. 14 Michail Bachtin, Probleme der Poetik Dostoevskijs (München:Hanser, 1971) 142. 15 Zu einer ausführlichen Analyse von Katja Lange-Müllers Schreibweise vor und nach 1989 vgl. Vf. Aus der Staatsgegnerschaft entlassen. Katja Lange-Müller und das Problem humoristischer Schreibweisen in der ostdeutschen Literatur der neunziger Jahre (Frankfurt/M.:Lang, 2003) 16 Katja Lange-Müller, Verfrühte Tierliebe (München:Deutscher Taschenbuch-Verlag., 1999) 92. 17 Katja Lange-Müller, Die Letzten - Aufzeichnungen aus Udo Posbichs Druckerei (Köln:Kiepenheuer und Witsch, 2000) 83f. 18 Bernhard Teuber, „Karneval als radikaler Dissens. Zur späten Übersetzung von Michail Bachtins Buch über Rabelais", Merkur 42 (1988): 507-512, hier: S. 511. |
||
|
|
|||