|
a peer reviewed scholarly journal on literature and art in the German speaking countries after 1945 ISSN 1093-6025
published at Dickinson
College |
G
l o s s e n: Gespräch
Carmen-Francesca
Banciu im Gespräch Es
folgt die bearbeite 1.
"Mein Vater", aus: Vaterfluchten
Was bedeutet
für dich „Ankunft“, in Deutschland, in Berlin? Berlin
ist mein Zwillingsbruder, denn wir waren beide gespalten. Von
unserer inneren Geschichte. Ich lebte in Rumänien und lebte
in einem Umfeld, mit dem ich nicht übereinstimmen konnte
und schwamm gegen den Strom. Und dann kam ich hierher und war
wieder gespalten, weil ich nicht wusste, ob ich mir erlauben darf,
meinen Wünschen nachzugehen. Ich stand am Anfang von etwas
neuem. Vor der Entdeckung einer neuen Welt, vor neuen Erfahrungen,
Erlebnissen, am Anfang einer Ich komme
aus einer Familie, die Genuss verpönt hat. Meine Eltern waren
beide Parteifunktionäre und strenge Kommunisten. Dazu war
meine Mutter religiös erzogen, aber sie war keine religiöse
Person mehr, sie hatte aber von der Religion die Strenge auf sich
übertragen und die wollte sie auf mich übertragen und
so kam Religion und Politik in einer Kombination, die sehr, sehr,
sehr lebensfeindlich war. Und vom Genuss – Genuss war keine
Schande, sondern war Frivolität! Man hatte Pflichten und
Pflichten, die über Generationen tradiert wurden ... Man
hatte die Pflicht, etwas zu tun, was für Generationen wichtig
ist, also über Generationen hinaus und das Leben war nicht
leicht, es gab keine Leichtigkeit, sondern es gab nur Strenge
und Ernsthaftigkeit und in diesem Sinne wurde ich erzogen und
wurde meine Generation und die Generationen, die im Kommunismus
aufgewachsen sind erzogen. „Freude“ war ein vergessenes
Wort. Ein vergessener Ort. Es war überhaupt kein Thema. Und
als ich hierher kam, hörte ich immer wieder, wenn es mir
nicht gut ging - und es ging mir nach einiger Zeit gar nicht gut:
„Tu was schönes, mach was schönes für Dich,
mach eine Kerze an, höre Musik, geh spazieren, tu etwas,
was Dir gut tut, freue dich,“. Und ich war so verblüfft
und wusste damit überhaupt nichts anzufangen. Ich beobachtete
die anderen Menschen und hatte das Gefühl, für die ist
das Leben so leicht, also leicht in dem Sinne, dass es von Leichtigkeit
geprägt ist und von Fröhlichkeit. Ich hingegen hatte
das Gefühl, mir ist alles auf den Schultern geladen und ich
kann mich kaum bewegen! Und das musste ich abgeben, abgeben letztendlich
und lernen von den anderen hier. Und ich hörte immer wieder,
ach, wir Deutschen, wir müssen uns ein Beispiel nehmen an
den südlichen Ländern, an den mediterranen, an Italien,
Spanien. Hier träumt jeder von dem Süden und wenn ich
sagte, wie wohl ich mich hier fühle und wie viel ich hier
gelernt habe und wie viel Freude und Lust am Leben ich hier entdeckt
habe und den Genuss, dann haben sich alle totgelacht und verstanden
nicht, was ich meinte. Und ich hab gedacht: mein Gott, wo hab
ich denn gelebt, dass mir das, was hier ist, so freudvoll und
lebensbejahend erscheint. Aber so ist das. Da sehe
ich eine Explosion von Licht, von Sonne und von Sternen gleichzeitig.
Es ist etwas lichtvolles. Und etwas sehr Warmes. Die Farbe
rot ist etwas, was ich verbinde mit einem Gefühl von Geborgenheit
und Liebe. Aber das ist ja nichts neues, denn rot ist ja mit Liebe
verbunden. Und Kraft. Explosive Kraft. Ich würde
es gerne streichen. Ich glaube, man braucht keine Pflichten. Man
braucht das Leben. Wenn man im Einklang mit sich selbst ist, dann
braucht man keine Pflichten. Dann tut man alles, was für
einen selbst gut ist und für die anderen. Und dann gibt es
keine Pflicht. Pflicht ist mit Schwere und Zwang verbunden. Und
das widerspricht eigentlich dem Leben. Es sind
zwei Berufe. Und zwei Fulltimejobs. Mutter, erziehende Person
zu sein und Liebe gebende Person zu sein und Schriftstellerin.
Das sind keine leichte Aufgaben, aber sie widersprechen sich nicht.
Und ich glaube auch, ich merke, das Wort Pflicht kommt sehr oft
vor in meinem Wortschatz. Ich entdecke immer wieder, wenn man
das tut, was man gerne tut, also aus freien Stücken, wenn
man seine Kinder erzieht, und das tut man ja gerne, weil man liebt
sie, das ist nicht etwa, was man sich denkt, sondern das spürt
man, das fühlt man, also wenn man das beste für seine
Kinder tut, dann gehört dazu, sie zu erziehen und ihnen das
Leben zu ermöglichen: wohnen, das ganz banale, den Alltag,
das Geld zu verdienen und so weiter. Und dann ist das keine Pflicht,
sondern es ist das Gefühl, dass aus Liebe dann auch alles
getan wird. Manchmal ist es nicht so einfach, aber es ist selbstverständlich.
Es ist
so sehr ein Teil von mir geworden. Ich hab eigentlich die meisten
Sachen im Café oder in der Kneipe geschrieben. Am Anfang
aus absoluter Not, weil ich kein eigenes Zimmer hatte, dann weil
ich zuhause von all den anderen Aufgaben abgehalten oder verführt
oder abgelenkt war, aber nicht nur deswegen, sondern weil ich
das Bedürfnis habe, Menschen in meiner Nähe zu spüren,
zu hören, ohne dass ich unbedingt einen Kontakt mit ihnen
aufnehme. Dieses Geräusch im Café, das Gemurmel von
Stimmen, das Summen, das Klackern von Geschirr, das alles gibt
mir das Gefühl von Geborgenheit, von Gelassenheit. Café,
das assoziiert man ja auch mit einer gelasseneren Stimmung, mit
Zeit für sich selbst haben und das, was man gerne tut und
letztendlich für sich selbst. - Wenn ich im Café bin,
kann ich sehr gut arbeiten, ich kann sehr gut die Verbindung zur
Außenwelt so herstellen oder auch filtern, dass zu mir nur
das kommt, was ich haben möchte und was ich brauche. Manchmal
beeinflusst mich das, inspiriert mich das, manchmal brauch ich
das gar nicht und manchmal vergesse ich das auch und bin so auf
meine eigenen Sachen konzentriert, dass ich gar nicht merke, wo
ich bin. Dann ich bin in einer Geschichte drin. Ich merke, dass
ich manchmal so Zeiten habe, wo ich denke, ich müsste jetzt
mal wieder zuhause arbeiten. Aber das geht nur für kurze
Zeit gut, dann werde ich langsam depressiv und weiß nicht
warum und irgendwann sage ich: Ach, Du musst mal wieder raus,
Du musst wieder ins Café, das ist es. Und dann tu ich das
auch und dann geht das wieder und wieder entdeckt man die Leichtigkeit
und die Lebensfreude. Und letztendlich geht es um Menschen und
wenn man Menschen liebt, dann muss man draußen sein. Ich schreibe
auch über dieses Café. Ich schreibe aber auch nicht
nur über dieses Café, sondern auch die anderen Bücher
sind in Cafés entstanden, ohne dass man über die Cafés
selbst was schreibt oder sich mit ihnen beschäftigt im Text.
Aber im Falle „Berlin ist mein Paris“ ist das Café
natürlich auch ein Zentrum oder ein Ausgangspunkt, von wo
man die Welt betrachtet oder immer wieder zurückkehrt und
anknüpft oder das Gefühl hat, da ist der Mittelpunkt.
Und man kann immer wieder raus und immer wieder zurück. Also mit
der Tradition ist das so eine Sache. Wenn man was übers Café
schreibt, oder was die Autoren, die im Café schreiben,
betrifft, ja. Hemingway ist derjenige, der meine Phantasie geweckt
hat in dieser Richtung. In seinem Buch „Ein Fest fürs
Leben“ erzählt er ja ganz viel über seine Cafés
und Restaurants, wo er einen großen Teil seines Tages lebt
und schreibt und arbeitet. Das beflügelte natürlich
meine Phantasie, auch in Rumänien in einer Zeit, wo man überhaupt
nicht aus der Enge raus konnte. Das war Hemingway einerseits und
das war Paris andererseits, der Ort, wo Künstler sich mit
der Welt messen. Paris war auch die weite Welt unter anderem.
Da Hemingway so viel darüber geschrieben hat, es ist eine
Art Tradition, die mir Ja, Paul
Celan ist auch ein wichtiger Autor und wenn wir zu der Geschichte
kommen „Genuss ist ein Wort aus Deutschland“, dann ist
das auch eine Gegenüberstellung von einem Gedicht, was aber
ein ganz anderes Bild von Deutschland gibt, nämlich „Der
Tod ist ein Meister aus Deutschland“. Ich wollte dem nicht
mit Absicht ein anderes Bild geben, aber es hat sich so entwickelt
und ich fand das sehr passend. Weil nichts einseitig ist, sondern
alles aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten ist. Und dann gehört
auch „Genuss ist ein Wort aus Deutschland“ zu einem
Deutschlandbild. Kreatives
Schreiben ist etwas, was mich am Anfang gar nicht beschäftigt
hat. Ich wusste, dass viele amerikanische Autoren das unterrichten,
teilweise auch aus finanziellen Gründen. Was mich betrifft,
ich habe das Meiste für mich lernen müssen, am besten
alleine und insofern wäre für mich eine Teilnahme an
einem Kurs wahrscheinlich nicht möglich, weil ich jemand
bin, der alleine Dinge entdecken muss und Wege. Wenn ich
auf der Straße mit jemandem bin, dann seh ich einfach nicht,
wo ich bin und kann den Weg nicht mehr das zweite Mal finden,
aber wenn ich den gleichen Weg alleine gehe, dann weiß ich,
wo ich bin. Und ähnlich geht’s mit allen Dingen. Aber
ich muss zugeben, als ich gefragt wurde, ob ich denn nicht so
einen Kurs leiten möchte, war ich erst mal ganz überrascht
und glaubte, dass ich das gar nicht kann. Ich war sehr verunsichert,
was könnte ich denn den anderen beibringen und habe mir Gedanken
gemacht und bin dann auf den Gedanken gekommen, dass ich den anderen
nur das beibringen kann, was mich beschäftigt. Oder anders
gesagt, was ich denen am besten beibringen kann ist: zu beobachten,
zu sehen, ihre Wahrnehmung zu erweitern und Dinge intensiver wahrzunehmen.
Auch Details wahrzunehmen und auch diese Details abzuarbeiten,
um ein Ganzes herzustellen und auch aus Details das wichtige zu
selektieren, das exemplarische, um etwas besonderes auszudrücken.
Und dann waren oft Dinge, die mich selbst beschäftigen, Themen,
die mich selbst beschäftigen, zum Beispiel das Thema Zeit,
das mich immer noch beschäftigt. Oder Perspektiven. Aus wie
vielen Perspektiven man etwas erzählen kann. Also aus übereinander
gelegten Perspektiven. Von einer Figur, die erzählt, dass
ihr erzählt wurde, dass ihr erzählt wurde und so weiter.
Wie weit kann man das treiben? Wie viel subjektives braucht man,
um so objektiv wie möglich sein? Das waren einige Themen, die mich beschäftigt haben, und über die ich in meinen Büchern auch versucht habe zu schreiben oder mit ihnen zu arbeiten. Und das war auch eine Art, den anderen zu helfen, sich mit den Themen zu beschäftigen und auch ihre Sicht zu entdecken und es eventuell weiterzuführen. Ich habe auch meine Ergebnisse vorgelesen und habe gesagt, ja das ist meine Sicht oder so weit bin ich gekommen, was könnt ihr denn? Oder manchmal habe ich ihnen dieselbe Aufgabe gegeben, die ich mir selber gestellt habe, um zu sehen, wie unterschiedlich wir sind und wie weit wir gehen können. - Es sind sehr oft Texte entstanden, die für mich mehr waren als Aufgaben, es waren oft schon literarische Texte! Und das freut mich jedes Mal, wenn junge Autoren oder Leute, die sich mit dem Schreiben beschäftigen, über die Übungen hinaus für sich etwas wertvolles schreiben können. Und ich glaube, manchmal gelingt es mir, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Sicht zu erweitern und ihre Sensibilität. Und sich auch zu befreien von Druck, von Stress von einer Starre, mit der wir alle zu kämpfen haben und einfach losschreiben. Und Dinge entdecken, an die sie einen Tag zuvor nie gedacht hätten.
copyright: Glossen, Oktober, 2004
| |
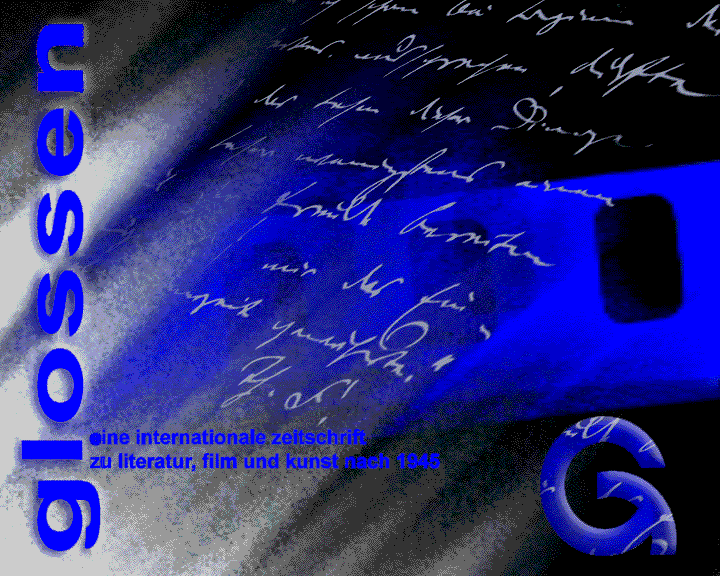
 te
Transkription einer im Berliner Café „Sale e Tabacchi“
produzierten Videoaufzeichnung mit Carmen-Francesca Banciu. Die
Fragen stellte Christel Blumensath, Bild- und Tongestaltung: Heinz
Blumensath. Ergänzt wird das Gespräch durch den Proustschen
Fragebogen und vier Filmen mit vier kurzen, von Frau Banciu gelesenen
Texten:
te
Transkription einer im Berliner Café „Sale e Tabacchi“
produzierten Videoaufzeichnung mit Carmen-Francesca Banciu. Die
Fragen stellte Christel Blumensath, Bild- und Tongestaltung: Heinz
Blumensath. Ergänzt wird das Gespräch durch den Proustschen
Fragebogen und vier Filmen mit vier kurzen, von Frau Banciu gelesenen
Texten: Entwicklung. Und das passierte auch mit Berlin. Berlin als gespaltene
Stadt, die zusammenwachsen soll und die zusammenwächst und
die unterschiedlichen Teile haben unterschiedliche Geschichten
und die sollen ja zusammenwachsen und dadurch soll etwas neues
entstehen und neue Erfahrungen, die einmalig sind für beide
Seiten. Und diese Entwicklung parallel zu beobachten zu meiner
Entwicklung, bedeutet für mich eine sehr große Nähe
zu dieser Stadt. Und ich empfinde es aus diesem Grunde eben, dass
wir Zwillingsbrüder sind.
Entwicklung. Und das passierte auch mit Berlin. Berlin als gespaltene
Stadt, die zusammenwachsen soll und die zusammenwächst und
die unterschiedlichen Teile haben unterschiedliche Geschichten
und die sollen ja zusammenwachsen und dadurch soll etwas neues
entstehen und neue Erfahrungen, die einmalig sind für beide
Seiten. Und diese Entwicklung parallel zu beobachten zu meiner
Entwicklung, bedeutet für mich eine sehr große Nähe
zu dieser Stadt. Und ich empfinde es aus diesem Grunde eben, dass
wir Zwillingsbrüder sind. gefällt. Andererseits, was die Literatur betrifft, hab ich
von ihm sehr, sehr viel gelernt, aber wenn ich an Vorbilder denke,
dann ist das nicht Hemingway. Die Tradition oder das Vorbild in
literarischem Sinn ist für mich nicht Hemingway, sondern
Virginia Woolf oder seine Texte aus dieser Pariser Zeit, als Hemingway
da gelebt hat. Dann noch u.a.: Gertrude Stein, Dunja Barnes, die
ich sehr schatze, und dann gibt es als Vorbild auch noch ganz
andere Autoren, nämlich Faulkner, und auch die Russen! -
Ich habe von sehr vielen was gelernt. Ich kann nicht sagen, ich
schreibe in der Tradition von jemandem anderen, ich lerne von
da und von dort und verwende oder versuche, das alles, was ich
gelernt habe, dann in einer Form umzusetzen, die vielleicht doch
mit mir was zu tun hat. Und eine Ausdrucksweise zu finden, die
doch mit mir was zu tun hat. Und wo man dann vielleicht mich erkennt
als Autorin.
gefällt. Andererseits, was die Literatur betrifft, hab ich
von ihm sehr, sehr viel gelernt, aber wenn ich an Vorbilder denke,
dann ist das nicht Hemingway. Die Tradition oder das Vorbild in
literarischem Sinn ist für mich nicht Hemingway, sondern
Virginia Woolf oder seine Texte aus dieser Pariser Zeit, als Hemingway
da gelebt hat. Dann noch u.a.: Gertrude Stein, Dunja Barnes, die
ich sehr schatze, und dann gibt es als Vorbild auch noch ganz
andere Autoren, nämlich Faulkner, und auch die Russen! -
Ich habe von sehr vielen was gelernt. Ich kann nicht sagen, ich
schreibe in der Tradition von jemandem anderen, ich lerne von
da und von dort und verwende oder versuche, das alles, was ich
gelernt habe, dann in einer Form umzusetzen, die vielleicht doch
mit mir was zu tun hat. Und eine Ausdrucksweise zu finden, die
doch mit mir was zu tun hat. Und wo man dann vielleicht mich erkennt
als Autorin.